Prof. Dr. Christoph Neuberger
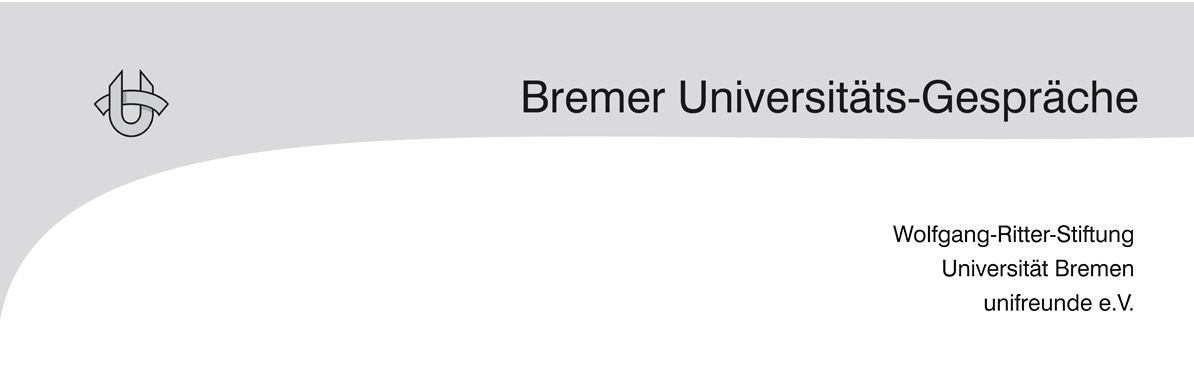
Zur Zukunft des Journalismus im Digitalen
Wenn man über die Zukunft des Journalismus sprechen will, so sollte man zunächst einmal auf seine Gegenwart eingehen. Das Internet, welches den Journalismus durcheinandergewirbelt hat, ist ja mittlerweile schon seit ungefähr zwei Jahrzehnten ein Medium von öffentlicher Relevanz. Das heißt, wir haben schon einiges an Erfahrungen sammeln können. Der Journalismus hat im Internet, wie wir wissen, seine Monopolstellung als Gatekeeper verloren, also als jene Instanz, die die letzten Entscheidungen darüber treffen kann, was veröffentlicht wird und was nicht. Die Möglichkeiten der Partizipation und Interaktion sowie die erhöhte Transparenz, die wir dort finden, haben an der Öffentlichkeit viel verändert. Politische Gruppen, aber auch andere Gruppen, die partikulare Interessen verfolgen, sind nun in der Lage, direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Das Publikum kann im Internet nicht nur auf eine große Informationsfülle zugreifen, sondern kann sich auch selbst in den sozialen Medien zu Wort melden.
Der professionelle Journalismus und die klassischen Massenmedien haben das Internet in den 1990er Jahren zunächst einmal eher ignoriert. Es gab wenige, die es euphorisch begrüßt haben, wenige sahen darin aber auch eine mögliche Konkurrenz. Spätestens seit der Jahrtausendwende, seitdem es ab dem Jahr 2001 erhebliche Einbrüche auf den Werbemärkten gegeben hat, nimmt man dieses Medium ernst. Seither haben wir ihm gegenüber eher eine kritische, eine negative Haltung. Zumindest ist viel davon die Rede, dass der Journalismus in die Krise geraten sei. Diese Krise ist aber nicht nur eine ökonomische. Möglicherweise ist das der Aspekt, der am evidentesten ist, weil er sich auch am besten durch Zahlen ausdrücken und nachweisen lässt. Hier sollen dagegen drei verschiedene Krisen unterschieden werden, bevor dann der Frage nachgegangen wird, wie sich der Journalismus in Zukunft weiterentwickeln kann. Fixe Prognosen sollen jedoch nicht aufgestellt, sondern Optionen aufgezeigt und Empfehlungen gegeben werden, wie sich der Journalismus weiterentwickeln könnte.
Zunächst einige Worte zur ökonomischen Krise, die uns schon seit etwa 15 Jahren deutlich vor Augen steht: Sie hat damit zu tun, dass die traditionellen Massenmedien, insbesondere die Tageszeitungen, an Reichweite verlieren. Zugleich verlieren journalistische Angebote sowohl in den klassischen Medien als auch im Internet an Relevanz als Werbeträger, weil es im Internet sehr viele neue und bessere Möglichkeiten der Werbung gibt wie zum Beispiel die Personalisierungsmöglichkeiten, die Google bietet. Abgesehen davon ist auch die Zahlungsbereitschaft des Publikums für journalistische Inhalte nach wie vor sehr gering.
Diese drei Erklärungen für die ökonomische Krise basieren auf Zahlen aus der Langzeitstudie Massenkommunikation von ARD und ZDF, die diese Umschichtung sehr deutlich machen: hin zum Internet, weg von den alten Medien (Breunig/van Eimeren 2015: 511). Bei den 14- bis 29-Jährigen fällt diese Abwanderung noch sehr viel drastischer aus als in den älteren Bevölkerungsgruppen (ebd.: 512). Wir haben bei den Jüngeren bereits eine tägliche Nutzungsdauer des Internets von etwa drei Stunden. Wir haben eine sinkende Nutzungsdauer beim Fernsehen, ebenso beim Radio. Bei der Tageszeitung verschwindet hier unten schon fast vollständig. Hier sind die Einbrüche besonders erheblich. Interessant ist auch, was die jungen Leute im Internet suchen. Wenn man sie nach den Nutzungsmotiven fragt (Breunig/Engel 2015: 330), geht es ihnen – ganz entgegen dem Vorurteil – eben nicht nur um Unterhaltung, es geht nicht nur um Smalltalk, es geht nicht nur um Computerspiele, sondern auch ganz stark um Informations- und Wissensnutzung. Das Internet überholt hier mittlerweile deutlich die klassischen Medien wie das Fernsehen, den Hörfunk und auch die Tageszeitung. Das gilt, wenn man die Gesamtheit der Bevölkerung ansieht, noch nicht. Dort liegt bei der Informations- und Wissensnutzung immer noch das Fernsehen an erster Stelle. Bei den jüngeren Leuten trifft dies schon nicht mehr zu. Man könnte nun vermuten, dass die jungen Leute dann, wenn sie älter geworden sind, auf den richtigen Weg finden werden, nämlich hin zu den klassischen Medien. Dass diese Hoffnung vergeblich sein dürfte, zeigt eine Kohorten-Analyse des Instituts für Demoskopie in Allensbach, für die in Fünf-Jahres-Abständen die verschiedenen Altersgruppen nach ihrer Zeitungsnutzung gefragt wurden (Schneller 2015: 901). Daran kann man sehen, dass diejenigen, die schon im frühen Alter angefangen haben, Tageszeitung zu lesen, das auch weiterhin machen, wenn sie älter geworden sind. Und umgekehrt: Diejenigen, die in jungen Jahren wenig Zeitung gelesen haben, werden auch dann, wenn sie älter werden, nicht anfangen, die Tageszeitung zur Hand zu nehmen.
Zur Zahlungsbereitschaft: Auch hier hat man im Internet ein großes Problem, weil die Leute zwar für journalistische Informationen zahlen, wenn sie gedruckt sind, aber damit dann, wenn sie in elektronischer Form kommen, nach wie vor sehr zurückhaltend sind. Dies zeigt ebenfalls die Allensbacher Studie, nach der nur ungefähr vier Prozent der Nutzer im Internet für Informationen von Tageszeitungen bezahlt haben, acht Prozent sind daran interessiert (Schneller 2015: 0897/2.7.2015). Es ist also immer noch ein minimaler Anteil, der dafür bezahlen will. Insofern haben wir eine deutliche ökonomische Krise im Journalismus.
Ich behaupte aber: Es gibt noch zwei weitere Krisen. Es gibt zweitens eine Identitäts- und Qualitätskrise des Journalismus. Was ist damit gemeint? Im Internet kommt es zu einer Entgrenzung des Journalismus. Es ist immer schwerer feststellbar, was denn überhaupt Journalismus ist. Es sind vor allem zwei Grenzen, die man hier in den Blick nehmen kann: zum einen die Grenze hin zu den Amateuren, zum sogenannten Bürgerjournalismus. Viele geben sich hier selbst das Etikett Journalismus. In Einzelfällen leisten Amateure durchaus Respektables – aufs Ganze gesehen ist der Bürgerjournalismus aber nicht konkurrenzfähig (Neuberger 2016: 6-9). Zum anderen geht es um die Grenze zu den Vertretern partikularer Interessen, die dafür Public Relations und Werbung betreiben. Sie haben nun im Internet einen direkten Zugang zu ihren Zielgruppen bekommen, seien es Kunden im wirtschaftlichen Bereich oder Bürger im politischen Bereich. Sie geben sich gerne den Anschein von Journalismus, imitieren den Journalismus, so dass es für das Publikum immer schwieriger wird, den Unterschied zu erkennen. Mittlerweile belegen auch Studien, dass es für das Publikum schwierig wird, die Unterschiede festzustellen, wie etwa in einer Befragung, die ich 2011 durchgeführt habe (Neuberger 2012: 52): Jeweils rund ein Viertel der Internetnutzer sagt, dass es ihnen schwer fällt, im Internet Journalismus zu erkennen, und dass es auch schwer ist, die Qualität von Angeboten richtig einzuschätzen. Hier ist unklar, an welchen Standards sich die entsprechenden Anbieter orientieren. Dies bestätigen auch andere Studien, die darauf verweisen, dass die Informationsnutzung zunehmend oberflächlich wird und immer weniger quellenkritisch ist. Eine gewisse Wahllosigkeit stellt sich ein. So wird häufig Google genannt, wenn Nutzer offen über ihr Informationsverhalten befragt werden – und nicht die dahinter liegenden Quellen, auf die es eigentlich ankommt (Hasebrink/Schmidt 2012: 35, 37, 39, 54). Im Jahr 2013 stimmten 30 Prozent der Befragten „eher“ oder „voll und ganz“ dem Statement zu: „Ich merke nicht wirklich, welche Webseite ich verwende. Ich sehe mir Nachrichten an, die mich interessieren.“ (Hölig/Hasebrink 2013: 533) Für die Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit einer Nachrichtenquelle sind der Name des Angebots oder des Journalisten in jüngeren Publikumsgruppen weniger wichtig als in älteren (Hölig/Hasebrink 2014: 537). Mittlerweile nutzen 18- bis 24-Jährige soziale Netzwerke stärker, um sich politisch zu informieren, als (Print- und Online-)Zeitungen (ebd.: 538). In Wahlkämpfen informieren sich Bürgerinnen und Bürger zunehmend auch auf den Webseiten der Parteien und Politiker (z. B. BITKOM/Forsa 2013: 4). Es gibt eine interessante Studie des Pew Research Centers aus den USA, in der zusätzlich auch nach den Motiven gefragt wurde, weshalb man den Politikern in den sozialen Medien folgt (Smith 2014: 4). Immerhin rund ein Viertel der Befragten sagt: Dort bekomme ich verlässlichere Informationen als bei den Nachrichtenmedien. Dies sind alles Indizien dafür, dass es einigen Nutzern nicht mehr so sehr darauf ankommt, wo sie ihre Nachrichten herbekommen, und auch dafür, dass weniger Wert auf seriöse Quellen gelegt wird.
Noch ist die Lage nicht dramatisch. Dass die Qualitätsvorteile im Wesentlichen noch beim professionellen Journalismus gesehen werden, zeigte eine Befragung aus dem Jahr 2011: Hier wurden deutsche Internetnutzer gefragt, welchen Angeboten sie Qualitätskriterien wie Glaubwürdigkeit, Aktualität, Sachlichkeit und Themenkompetenz am ehesten zuschreiben (Neuberger 2012: 48). Die Presse-Websites schneiden hier am besten ab, gefolgt von den Rundfunk-Websites. Allerdings sind durchaus soziale Medien bei einzelnen Items relativ stark. Vor allem die Wikipedia, der zum Beispiel ein höheres Maß an Unabhängigkeit als den professionell-journalistischen Websites zugeschrieben wird.
Die Identitäts- und Qualitätskrise hat noch eine zweite Facette. Es ist nicht nur so, dass andere Akteure anfangen, sich dem Journalismus anzunähern. Zugleich ist der professionelle Journalismus gezwungen, auch selbst seine Gestalt zu verändern. Er muss im Internet seine neue Rolle finden. Dort reicht es nicht mehr aus, was er in den klassischen Medien gemacht hat, nämlich Ein-Weg-Kommunikation. Er muss sich auch hier öffnen und die besonderen Möglichkeiten dieses Mediums ausnutzen. Doch damit nicht genug. Es gibt darüber hinaus eine dritte Krise: eine Glaubwürdigkeitskrise, von der man sagen kann, dass sie – im wörtlichen Sinn – herbeigeredet wurde. Im Internet kann der Journalismus die Kritik über sich selbst nicht mehr kontrollieren, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Damals konnte man Leserbriefe schreiben, und die Redaktion hat entschieden, ob ein journalismuskritischer Leserbrief veröffentlicht wird oder nicht. Es lag also weitgehend in der Hand des Journalismus, die Kritik an sich selbst zu kontrollieren. Das hat sich im Internet geändert. Dies hat positive Aspekte, wenn Sie etwa an Angebote wie das Bildblogdenken, das sehr detailliert und kritisch die Bild-Zeitung, mittlerweile auch andere Medien, begleitet.
Allerdings hat sich in den letzten ungefähr anderthalb Jahren noch eine ganz andere Art von Journalismuskritik im Internet herausgebildet, die nicht mehr nur punktuell Fehlleistungen moniert, sondern den Journalismus sehr pauschal und kampagnenhaft angreift. Oft stehen leicht durchschaubare politische Intentionen dahinter, vor allem im Kontext der PEGIDA-Bewegung. Das Schlagwort „Lügenpresse“ ist ja 2014 zum Unwort des Jahres gewählt worden. Man kann sich durchaus vorstellen, dass allein diese Debatte dazu beiträgt, dass der Journalismus an Glaubwürdigkeit verliert. Diejenigen, die den Lügenpresse-Vorwurf vortragen, argumentieren natürlich genau umgekehrt: Sie sagen, die Presse habe längst an Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung verloren, und sehen das als Folge angeblicher Missstände im Journalismus. Es wird kolportiert, dass der Journalismus mit politischen und wirtschaftlichen Eliten eng verflochten ist, dass er versucht, die Bevölkerung zu manipulieren, dass er absichtlich falsche Informationen weitergibt oder Brisantes unterschlägt, etwa im Kontext des Ukrainekonflikts oder auch jetzt im Rahmen der Flüchtlingsdebatte. Dies ist die dritte Krise des Journalismus, die man etwa festmachen kann am Buch Gekaufte Journalisten von Udo Ulfkotte. Ein Pamphlet, das sich über 120 000 Mal verkauft hat (Fleischhauer 2015: 98) und viele Monate auf der Spiegel-Bestsellerliste gestanden hat. Allerdings – und das meine ich damit, dass es eine „herbeigeredete“ Krise ist – lassen sich weder ein deutlicher Qualitätsverlust auf Seiten des Journalismus, noch ein abrupter Glaubwürdigkeitsverlust auf Seiten des Publikums seriös nachweisen (Reinemann/Fawzi 2016). Hier wird vielmehr versucht, eine für die Demokratie wichtige Institution vorsätzlich zu beschädigen.
Das sind also zunächst einmal diese drei Krisen des Journalismus, die ich unterscheiden möchte. Nach diesen drei Punkten zur Gegenwartsdiagnose habe ich nun vier Punkte zu der Frage: Wie kann die Zukunft des Journalismus aussehen? Ich möchte hier – wie angekündigt – keine Prognosen aufstellen, sondern ich möchte eher Überlegungen darüber anstellen, wie sich der Journalismus verhalten könnte und welche Möglichkeiten ihm dafür offen stehen.
Ein erster wichtiger Punkt, der möglicherweise ein bisschen banal klingt, ist die Empfehlung, dass der Journalismus lernen muss, sich in dieser neuen dynamischen, sehr turbulenten Umgebung zu bewegen und sich fortlaufend zu erneuern. Er braucht ein ausgefeiltes Innovationsmanagement. Nur dann wird es ihm gelingen, den vorhin beschriebenen Generationenabriss zu schließen. Er muss lernen, die vielen Möglichkeiten des Internets sinnvoll auszuschöpfen, und zwar durch systematisches Lernen, was auch eine ständige Rückkopplung durch Evaluation einschließt, vor allem durch ein kontinuierliches Publikums-Feedback. Da wurden viele Fehler gemacht in den letzten beiden Jahrzehnten. Ich habe diese These auch deshalb aufgestellt, weil es zuvor viele Jahrzehnte im Journalismus mehr oder weniger einen Stillstand gegeben hat. Vor allem bei den Tageszeitungen, die oft ein lokales Monopol besaßen, also keinen Wettbewerbsdruck verspürten und deshalb kaum Reformbedarf sahen. Das scheint mir im Vergleich auch zu vielen anderen Branchen eine besondere Schwäche des Journalismus zu sein. Wenige Verlagshäuser investieren in Forschung und Entwicklung – jenseits des Tagesgeschäfts, das dafür wenige Spielräume lässt. Was heißt das konkret im Fall des Internets? Es heißt zum Beispiel, dass der Journalismus nicht mehr monomedial denken darf. In der Vergangenheit gab es Zeitungsredaktionen, die nur für dieses Printmedium gearbeitet haben. Redaktionen müssen im wachsenden Maße crossmedial arbeiten. Sie müssen aber auch anfangen, und das betrifft dann vor allem die Internetredaktionen, dort eine Vielzahl von Kanälen zu bespielen. Es reicht keineswegs mehr aus, nur eine Website zu gestalten, sondern darüber hinaus müssen auch viele soziale Medien parallel noch mit Inhalten gefüllt werden. Außerdem müssen die Kanäle verknüpft werden. Wir haben das im Jahr 2014 in einer Redaktionsbefragung untersucht (Neuberger/Langenohl/Nuernbergk 2014). Wir wollten wissen, wofür Facebook, Twitter, Google+, YouTube und Blogs journalistisch eingesetzt werden. Zunächst ist es so, dass die meisten dieser Kanäle auch tatsächlich von den Redaktionen genutzt werden. Das spricht also dafür, dass diese Vielkanaligkeit schon Realität ist. Abgesehen davon ist es so, dass jeder dieser Kanäle auch wiederum ganz viel kann, also multifunktional ist. Soziale Medien werden nicht nur zum Publizieren eingesetzt, sondern auch zum Recherchieren, zur Publikumsinteraktion, zur Metakommunikation, also beispielsweise zur Werbung für das eigene Angebot, oder auch zum Monitoring, also zur Beobachtung des eigenen Publikums und der Konkurrenz. Das heißt, wir haben es hier mit ganz vielfältigen Möglichkeiten zu tun, was die Frage aufwirft: Ist schon klar, wofür man diese Angebote sinnvoll einsetzen kann? Das ist im Moment ein großer Lernprozess, in dem sich Leistungsprofile herauskristallisieren. Wir haben festgestellt, dass Facebook und Twitter besonders vielfältig verwendet werden. Sie sind eine Art Schweizer Taschenmesser des Journalismus geworden. Facebook wird etwa für die Diskussion der redaktionellen Beiträge eingesetzt, auch für die Beteiligung des Publikums am redaktionellen Produktionsprozess, für weichere Rechercheziele, beispielsweise, wenn es darum geht, Stimmungen in der Bevölkerung zu erkennen oder die Resonanz auf die eigene Berichterstattung zu beobachten. Twitter als schnelles Medium mit ganz kurzen Mitteilungen dient natürlich vor allem zur Echtzeitinteraktion, aber auch für kurze Eilmeldungen, die Liveberichterstattung, den Kontakt zu Experten und Prominenten sowie die Recherche von Fakten. Blogs und YouTube sind eher spezielle Angebote: Blogs sind für längerfristige Diskussionen, Hintergrundinformationen oder auch für das Schreiben von Kolumnen geeignet, YouTube natürlich für die Verbreitung eigener Videos. Wir sehen also: Jeder dieser Kanäle hat ein sehr eigenes Profil. Was ebenfalls noch eine Herausforderung ist, das sind Querverbindungen: Wie spielt man ein Thema über die verschiedenen Kanäle? Wir sehen also, dass die Komplexität der journalistischen Arbeit durch die Vielkanaligkeit deutlich zugenommen hat.
Was im Journalismus jedenfalls nicht mehr ausreicht, das sind die Produktion und die Auswahl von Nachrichten alleine. Dies nämlich entspricht der traditionellen Gatekeeper-Rolle. Es kommen nun neue Rollen für den Journalismus hinzu. Eine dieser Rollen – und das ist mein dritter Punkt zur Zukunft des Journalismus – ist die Moderatorrolle. Die Möglichkeiten der Partizipation und Interaktion im Internet werden bisher nur ansatzweise genutzt, um die öffentliche Meinungsbildung zu verbessern. Es ist für die Demokratie ganz wichtig, dass im öffentlichen Raum die verschiedenen Meinungen vorgetragen werden und dass hier, wenn man mit Jürgen Habermas argumentieren will, ein Diskurs stattfinden soll, der herrschaftsfrei, rational und respektvoll im Umgang ablaufen soll. Dass es oft anders ist, wissen wir. Und die Frage ist, wer denn jetzt im Internet die geeigneten Rahmenbedingungen für deliberative Diskurse schafft – und da sehe ich den Journalismus an erster Stelle. Allerdings müsste er dafür sein Rollenverständnis ändern, weil er bisher noch nicht gewohnt ist, auf Augenhöhe mit dem Publikum zu kommunizieren. Es gibt dafür leider wenige gute Beispiele, an denen man sehen kann, wie so etwas aussehen könnte. Ein Beispiel ist der Lesesaal der FAZ auf faz.net, der im September 2015 eröffnet wurde. Den gab es vor einigen Jahren schon einmal, er wurde aber damals – obwohl er viel Lob erntete – wegen geringer Publikumsresonanz wieder eingestellt. Jetzt gibt es einen Neustart. Dabei wird der Versuch unternommen, jede Woche gemeinsam mit den Lesern ein Buch zu diskutieren. Man bekommt Auszüge aus diesem Buch, eine Rezension der Redaktion, und man kann es absatzweise kommentieren, der Leser kann also mit den Redakteuren gemeinsam ein Buch durcharbeiten. Das ist ein anspruchsvoller Versuch, Bücher zu diskutieren. Allerdings ist auch diesmal die Resonanz noch minimal. Selbst in der FAZ-Leserschaft ist also die Bereitschaft gering, an einem solchen Projekt mitzuwirken.
Schließlich noch die Navigatorrolle. Immer mehr verlagert sich das gesellschaftliche Leben ins Internet, und den Nutzern fällt es, wie wir wissen, schwer, sich dort zurechtzufinden, die Informationslawine zu bewältigen, die uns da entgegenrollt. Auch hier sehe ich den Journalismus in der Pflicht: Als Navigator – andere Begriffe sind Kurator und Gatewatcher – soll er dem Publikum Orientierung geben, sei es durch Recherche, sei es durch Verlinkungen oder sei es durch die Kommentierung anderer Websites.
Schließlich bleibt noch als achter und letzter Punkt die Theoriefrage, ob wir in der Journalismusforschung einen breiteren Vermittlungsbegriff brauchen. Wir haben traditionell eine starke Fixierung auf den professionellen Journalismus. Wir erörtern mittlerweile, ob auch Amateure und Algorithmen journalistische Aufgaben übernehmen können. Im Bereich der Medienregulierung wird im Moment viel über die Rolle von Intermediären wie Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen, etwa Google und Facebook, diskutiert. Die Frage lautet hier, ob diese nicht genauso öffentliche Vermittlungsaufgaben haben und damit wie der Journalismus eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen. Denken sie etwa an die Hasskommentare auf Facebook und die Frage, ob diese gelöscht werden sollten. Ähnlich stellt sich im Fall von Google die Frage, inwieweit dort inhaltliche Verzerrungen bei den Suchergebnissen Meinungsbildungsprozesse beeinflussen könnten. Darüber hinaus scheint es mir auch wichtig zu sein, nicht immer nur den Journalismus im Blick zu haben, sondern auch die anderen publizistischen Teilsysteme. Dazu zähle ich Beratung, Bildung, Unterhaltung und Kunst. Wir erleben im Internet ein Verschwimmen dieser unterschiedlichen Sparten, die etwa im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks noch recht sauber getrennt sind. Wenn man sich beispielsweise die Website von Spiegel Online ansieht, dann findet man dort alles: neben Journalismus auch Beratung, Bildung, Unterhaltung und Kunst. Abgesehen davon, finden wir Vermittlung nicht nur in der Massenkommunikation, sondern auch in kleineren Öffentlichkeiten bis hin zu personalisierten Vermittlungsleistungen, etwa durch individuelle Expertenberatung oder auf selektiven Informationsmärkten, also etwa auf Stellen- und Partnermärkten. Ich glaube, wir haben noch keine umfassenden, auch theoretischen Vorstellungen davon, wie vielfältig Vermittlungsprozesse sind.
Weiterführende Literatur
- BITKOM/Forsa (2013): Demokratie 3.0. Die Bedeutung des Internets für die politische Meinungsbildung und Partizipation von Bürgern – Ergebnisse einer repräsentativen Befragung von Wahlberechtigten in Deutschland. In: BITKOM 7.8.2013.
https://www.bitkom.org/Publikationen/2013/Studien/Studie-Demokratie-3-0/BITKOM-Studie-Demokratie-30.pdf (Zugriff am 31.01.2016). - Breunig, Christian/Engel, Bernhard (2015): Massenkommunikation 2015. Funktionen und Images der Medien im Vergleich. Ergebnisse der ARD/ZDF-Langzeitstudie. In: Media Perspektiven. H. 7–8, S. 323–341.
- Breunig, Christian/van Eimeren, Birgit (2015): 50 Jahre „Massenkommunikation“: Trends in der Nutzung und Bewertung der Medien. Ergebnisse der ARD/ZDF-Langzeitstudie 1964 bis 2015. In: Media Perspektiven. H. 11, S. 505–525.
- Fleischauer, Jan (2015): Im Wald. Der ehemalige „FAZ“-Redakteur Udo Ulfkotte rechnet mit seiner Zeitung ab – und liefert damit einen Bestseller. Wer ist dieser Mann? In: Der Spiegel. H. 11, S. 98–100. http://magazin.spiegel.de/EpubDelivery/spiegel/pdf/132212276(Zugriff am 31.01.2016).
- Hasebrink, Uwe/Schmidt, Jan (2012): Informationsrepertoires der deutschen Bevölkerung. Konzept für eine regelmäßig durchzuführende bevölkerungsrepräsentative Befragung im Rahmen des Vorhabens „Erfassung und Darstellung der Medien- und Meinungsvielfalt in Deutschland“. Unter Mitarbeit von Suzan Rude, Mareike Scheler und Navra Tosbal. Hamburg: Hans-Bredow-Institut (= Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts 24). http://www.hans-bredow-institut.de/webfm_send/657 (Zugriff am 31.01.2016).
- Hölig, Sascha/Hasebrink, Uwe (2013): Nachrichtennutzung in konvergierenden Medienumgebungen. International vergleichende Befunde auf Basis des Reuters Institute Digital News Survey 2013. In: Media Perspektiven. H. 11, S. 522–536.
- Hölig, Sascha/Hasebrink, Uwe (2014): Nachrichtennutzung im Wandel: Neue Plattformen, Endgeräte und Zugänge. International vergleichende Befunde auf Basis des Reuters Institute Digital News Survey 2014. In: Media Perspektiven. H. 11, S. 530–538.
- Neuberger, Christoph (2012): Journalismus im Internet aus Nutzersicht. Ergebnisse einer Onlinebefragung. In: Media Perspektiven. H. 1, S. 40–55.
- Neuberger, Christoph (2016): Soziale Medien und Journalismus. In: Schmidt, Jan-Hinrik/Taddicken, Monika (Hg.): Handbuch Soziale Medien. Wiesbaden. Doi:10.1007/978-3-658-03895-3_6-1 (Zugriff am 31.01.2016).
- Neuberger, Christoph/Langenohl, Susanne/Nuernbergk, Christian (Hg.) (2014): Social Media und Journalismus. LfM-Dokumentation, Band 50. Düsseldorf.
- Reinemann, Carsten/Fawzi, Nayla (2016): Eine vergebliche Suche nach der Lügenpresse. Analyse von Langzeitdaten. In: tagesspiegel.de. 24.01.2016. http://www.tagesspiegel.de/politik/analyse-von-langzeitdaten-eine-vergebliche-suche-nach-der-luegenpresse/12870672.html (Zugriff am 31.01.2016).
- Schneller, Johannes (2015): Auf dem Weg zu neuen Gleichgewichten? Stabilität und Dynamik bei den Mustern der Mediennutzung. In: AWA 2015. Institut für Demoskopie Allensbach. http://www.ifd-allensbach.de/fileadmin/AWA/AWA_Praesentationen/2015/AWA_2015_Mediennutzung_Schneller.pdf (Zugriff am 31.01.2016).
- Smith, Aaron (2014): Cellphones, Social Media and Campaign 2014. In: Pew Research Center, November, 2014. http://www.pewinternet.org/files/2014/10/PI_CellPhonesSocialMediaCampaign2014_110314.pdf (Zugriff am 31.01.2016).
