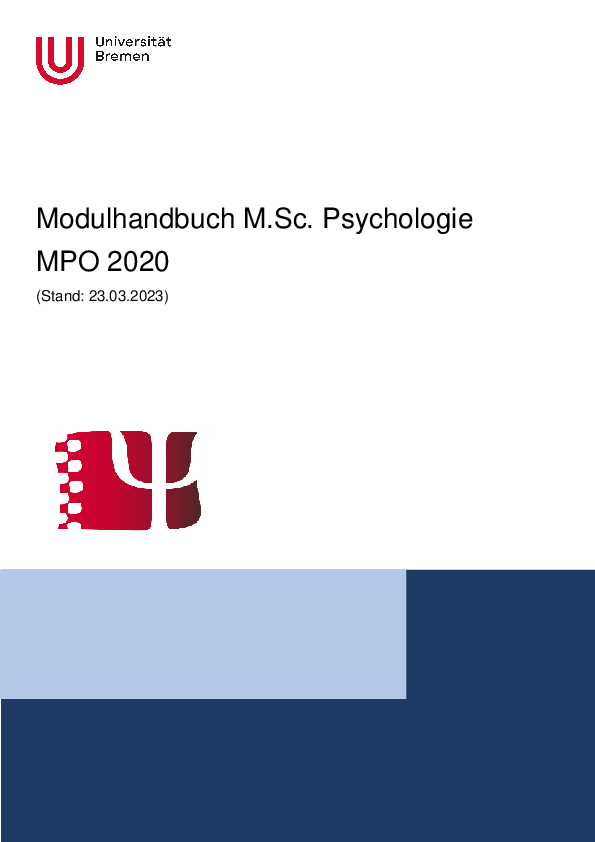Modulhandbuch M.Sc. Psychologie
Studienverlaufsplan des Masterstudiengangs „Psychologie“, MPO 2020
Dieser Studienverlaufsplan stellt eine Empfehlung für den Ablauf des Studiums dar. Module können von den Studierenden in anderer Reihenfolge besucht werden.
Modulhandbuch Studiengang M.Sc. Psychologie (MPO 2020)
Dateiname: MHB_MPO2020.pdfÄnderungsdatum: 24.03.2023
Die elektronische Version des Modulhandbuchs befindet sich zur Zeit in Überarbeitung. Bitte nutzen Sie das obige PDF-Dokument.