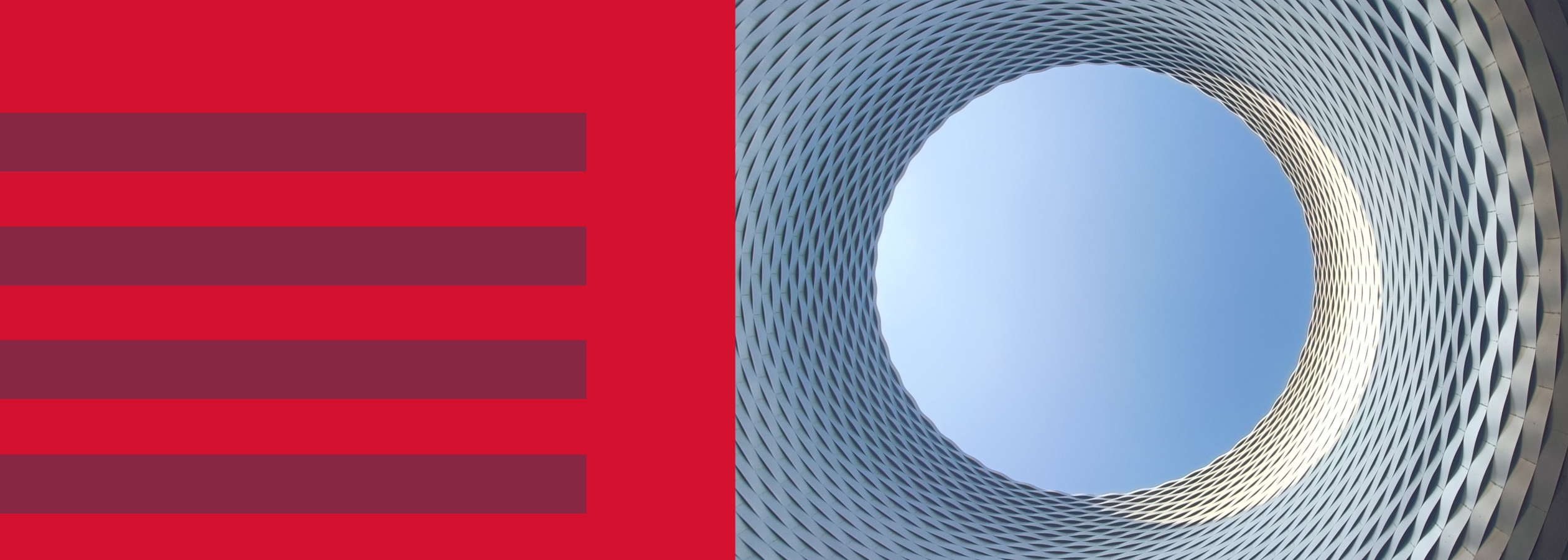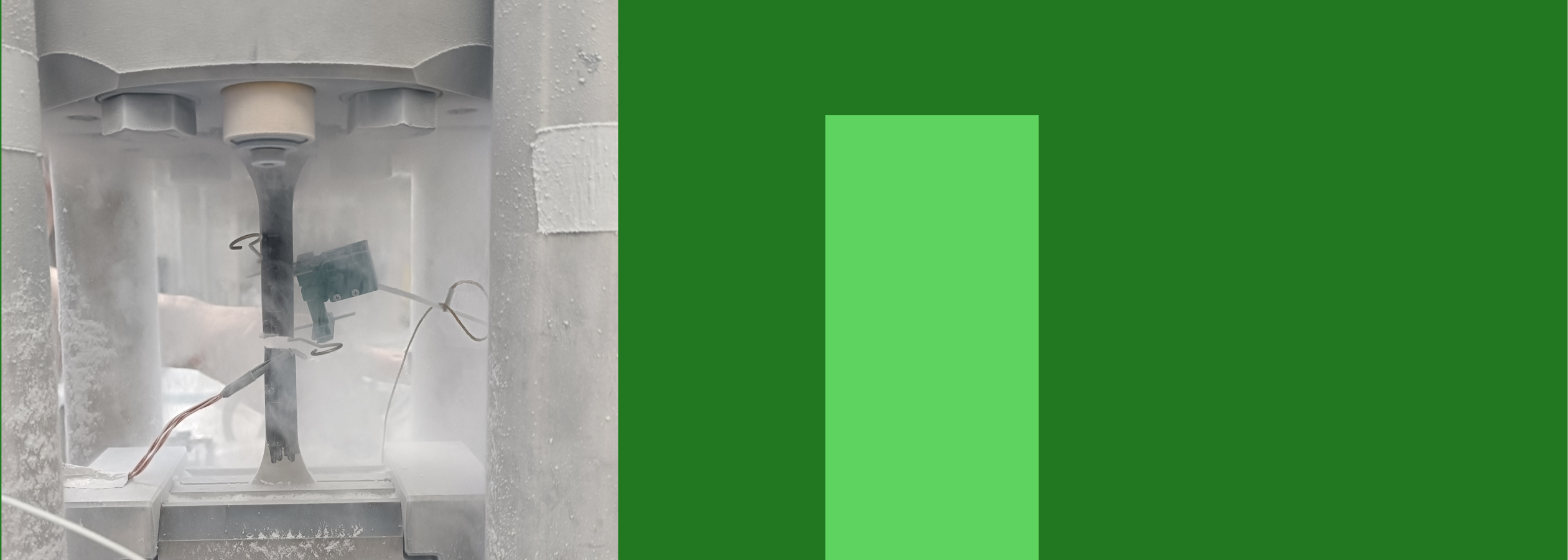Angewandte Elektronik- und Softwaresysteme
Willkommen beim Fachgebiet »Angewandte Elektronik- und Softwaresysteme«
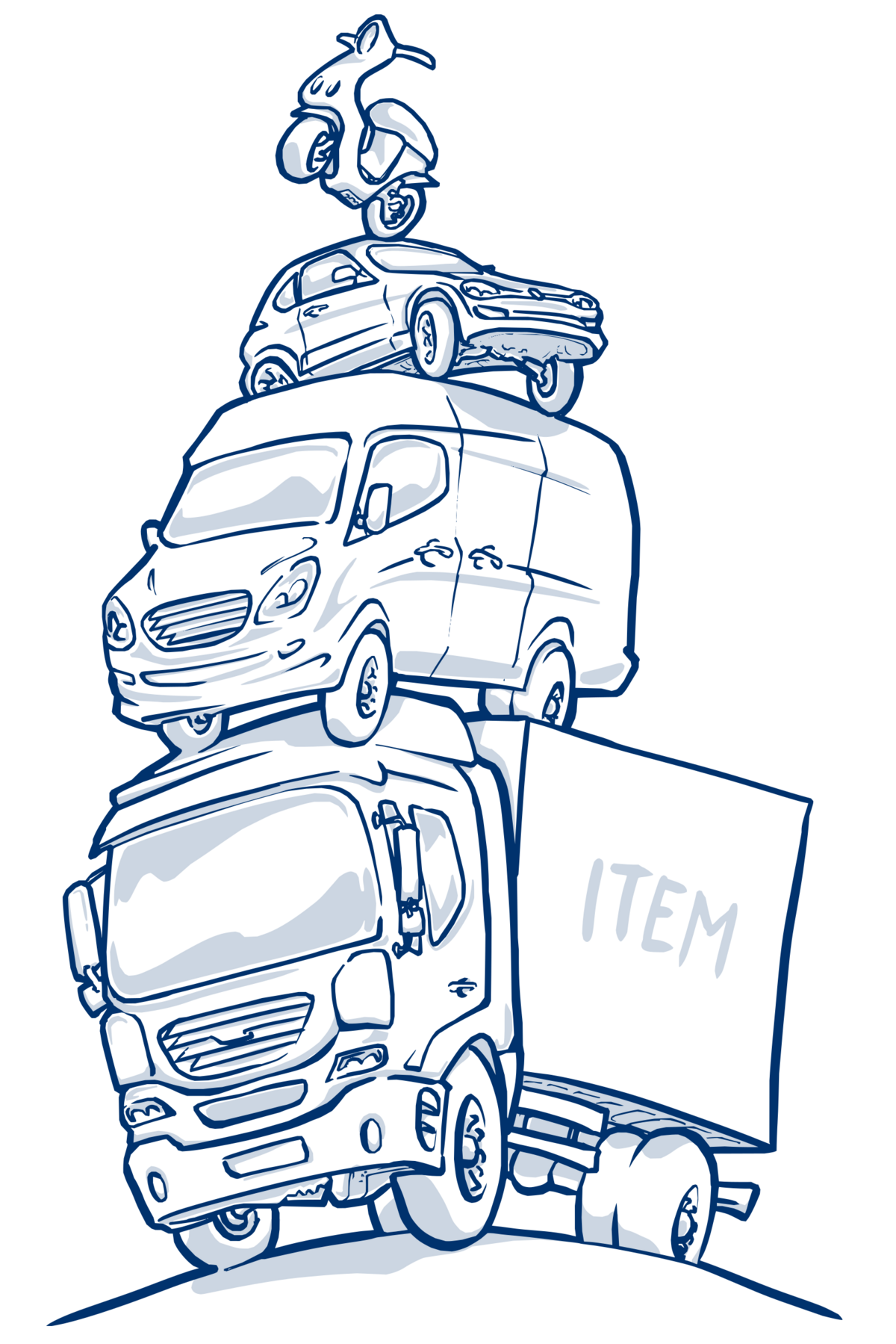
Das Fachgebiet »Angewandte Elektronik- und Softwaresysteme« beschäftigt sich mit der Entwicklung echtzeitfähiger Algorithmen und Elektroniksysteme für unterschiedliche Anwendungsfelder. Wir erforschen und entwickeln bereits seit mehr als 10 Jahren intelligente Sensorlösungen und nutzen dabei Verfahren der Künstlichen Intelligenz, um einen hohen Praxisnutzen zu erzielen.
Basierend auf unseren Forschungserkenntnissen und unserer Erfahrung entwickeln wir anwendungsspezifische Sensor- und KI-Lösungen für den Automobil-, Nutzfahrzeug-, Arbeitsmaschinen- und Avionik-Sektor. Dabei arbeiten wir eng mit unseren wissenschaftlichen und industriellen Partnern zusammen, um praxisgerechte und leistungsfähige Sensor- und KI-Lösungen im Verbund zu realisieren.
Neues aus dem Fachgebiet
Lehrinhalte in der praktischen Umsetzung erleben
Exkursionen in Bremer Unternehmen
Im Rahmen ihrer Vorlesungen besuchten im Februar Bachelor- und Master-Studierende der Studiengänge Elektrotechnik und Informationstechnik (ET/IT), Wirtschaftsingenieurwesen ET/IT sowie Systems Engineering die am Flughafen Bremen ansässigen Unternehmen HELLA Fahrzeugkomponenten GmbH (HFK) und Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Begleitet wurden sie vom Organisator der Exkursionen Prof. Karl-Ludwig Krieger, dessen Arbeitsgruppe in beide Unternehmen Verbindungen hat, so hat sie bereits im Rahmen mehrerer Projekte mit dem Unternehmen HFK kooperiert.
HFK entwickelt und fertigt elektromechanische und elektronische Komponenten für Kraftfahrzeuge und beschäftigt unter anderem Mitarbeiter aus den Bereichen Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik, Physik und Mechatronik. Im Werk Bremen werden beispielsweise jährlich mehr als 14 Millionen Regen-Licht-Sensoren für alle namhaften Fahrzeughersteller gefertigt. Während einer Führung durch die Produktionshallen lernten die Studierenden die einzelnen Fertigungsschritte verschiedener Sensorsysteme kennen.
Die BSAG betreibt einen Großteil des öffentlichen Nahverkehrs in Bremen. Im Jahr 2020 bestand die Flotte aus 121 Straßenbahnfahrzeugen und 232 Bussen. In den Werkstätten konnten die Studierenden sich einen Überblick über den aktuellen Stand der „Roadmap Elektromobilität“ des Unternehmens verschaffen.
Im Anschluss an die Besichtigungen konnten sich die Studierenden mit Ingenieuren der Unternehmen austauschen und mehr über den Alltag und die Arbeit von Ingenieuren erfahren.
"Exkursionen in Industrieunternehmen sollen Inhalte der Lehrveranstaltungen in der praktischen Umsetzung veranschaulichen und haben somit das Potential, die Studierenden im weiteren Verlauf ihres Studiums zu motivieren und bieten im besten Fall schon Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu einem zukünftigen Arbeitgeber in der Region“, zählt Exkursionsleiter Prof. Karl-Ludwig Krieger die Vorteile der Veranstaltungen auf.


Projekt VibroSenLH2
Ziel des Projektes „VibroSenLH2“ ist die Entwicklung eines Sensorsystems zur Echtzeitüberwachung von Flüssigwasserstofftanks (LH2: Flüssigwasserstoff) aus kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen (CFK) auf Materialermüdung (z. B. Mikrorisse, Wasserstoffversprödung). Diese Schädigungen resultieren in einer zunehmenden Undichtigkeit. Die Wasserstoffverluste verringern die Energieeffizienz. Aus Gründen der Betriebssicherheit müssen Tanks in festen Intervallen ausgetauscht werden. Dies steigert den Ressourcen- und Energieverbrauch durch die zusätzliche Fertigung und Entsorgung von Tanks und den Transport. Für die Überwachung der Speicher aus Metall oder Faserverbund und die echtzeitfähige Erkennung von Schäden existiert bisher keine geeignete Methode. Das angestrebte Sensorsystem wird die Entstehung und das Wachstum von Schädigungen intelligent und in Echtzeit überwachen. Die technologische Basis für die Überwachung sind die sich über eine Struktur ausbreitenden Körperschallsignale bei Schädigungsereignissen. Den Ausgangspunkt bilden die Entwicklung der Bauteilintegration von Körperschallsensoren und die Entwicklung des zugehörigen Messsystems. Beide Komponenten werden für die Fusion von aktivem und passivem Monitoring genutzt. Bei der aktiven Überwachung (Durchschallung) werden definierte Schallimpulse in die zu untersuchende Struktur eingebracht. Anhand der spezifischen Sensorantwort werden vorhandene Schädigungen festgestellt. Bei der passiven Methode (akustische Emissionen) wird eine Struktur kontinuierlich auf Schädigungsereignisse überwacht. Während Schadenentstehungs- und Wachstumsprozessen werden Körperschallwellen ausgesendet und von einem Sensor detektiert. Dies ermöglicht die Echtzeitfähigkeit. Dabei hebt die Kombination der beiden Methoden deren Einzelnachteile auf und stärkt die Vorteile.

Projekt MasterKI
Ziel des Projektes "MasterKI" ist die Entwicklung eines vernetzten multifunktionalen Edge-Zustandsüberwachungssystems für mobile Arbeitsmaschinen. Neben den Betriebsdaten werden auch die komplexen Aggregate der mobilen Arbeitsmaschinen überwacht, um damit die Marktdurchdringung der Überwachungssysteme für unterschiedlichste mobile Arbeitsmaschinen deutlich zu steigern. Das konfigurierbare multifunktionale Überwachungsmesssystem besteht aus drei Einheiten. Das „Edge-Messsystem“ ist durch eine variable Einbindung verschiedener I/O-Module, die Vernetzung mit der Arbeitsmaschine sowie eine dynamische Rekonfiguration der Messaufnahme flexibel für unterschiedliche Arbeitsmaschinen einsetzbar. Das „cloudbasierte Datenmanagement“ ermöglicht eine sichere und anonymisierte Datenspeicherung und mit geeigneten Schnittstellen via WEB- und APP-Applikation erhält der Anwender Zugriff auf Ergebnisse und die Konfigurationsoberfläche. Die Small-Data-Problematik von Arbeitsmaschinen wird durch den Einsatz eines „Datentransfermodells“ und „selbstoptimierende KI-Modelle“ gelöst und damit die Applikation des Überwachungssystems auf beliebige Arbeitsmaschinen ohne zusätzliche Entwicklungsaufwände ermöglicht.