Podiumsdiskussion: Die Zukunft von Medien, Kommunikation und Information
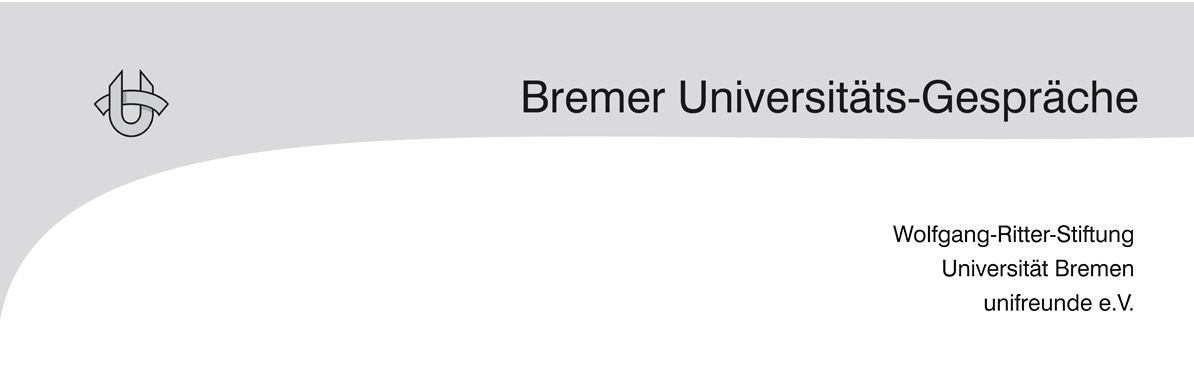
Es diskutierten
Moritz Döbler ist seit Januar 2015 Chefredakteur des Weser-Kuriers. Wie schon als geschäftsführender Redakteur beim Tagesspiegel ist er verantwortlich für die Weiterentwicklung des Blattes und für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder. Davor war Moritz Döbler bei den Nachrichtenagenturen dpa und bei Reuters.
Anke Domscheit-Berg, selbständige Beraterin, ist Expertin für Open Government und digitale Gesellschaft. Nach Stationen bei Microsoft und der IT-Beratung Accenture gründete sie das Portal OpenGov.me für Fragen des E- und Open Governments. Sie engagiert sich ehrenamtlich unter anderem für mehr Transparenz in der öffentlichen Verwaltung.
Dr. Leif Kramp ist Forschungskoordinator beim Zentrum für Medien, Kommunikation und Information (ZeMKI) der Universität Bremen. Er ist Autor und Mitherausgeber zahlreicher Fachbücher zu den Themen Medienwandel und Journalismus. Er moderierte die Podiumsdiskussion.
Nico Lumma ist Mitbegründer des Next Media Accelerators in Hamburg und als Medien- und Digitalunternehmer, Berater, Blogger und Digitalexperte tätig. in der Werbewirtschaft hat er Erfahrung bei bei Scholz & Friends und den Digital Pioneers gesammelt. Im Jahr 2012 wurde Nico Lumma von der Wirtschaftswoche zu einem der wichtigsten Köpfe des deutschen Internets benannt. Laut eigener Aussage ist er seit 1995 nicht mehr offline.
Jan Metzger ist Intendant von Radio Bremen und Schirmherr der 28. Bremer Universitäts-Gespräche. Zu Beginn seiner Karriere war er Auslandskorrespondent bei der ARD in Spanien und Portugal, hat dann die Reporterlaufbahn bis hin zum Hauptabteilungsleiter beim Hessischen Fernsehen durchlaufen und war zuletzt in der ZDF-Redaktion des heute-journals.
Kramp: Abschließend möchten wir mit unseren Gästen aus der Medienpraxis die Gelegenheit nutzen, unsere wissenschaftlichen Perspektiven mit Erfahrungen aus der Praxis abzugleichen und erfahren, wie denn die Wahrnehmung zu den vielen Thesen und empirischen Ergebnissen ausfällt, die uns im Laufe des Tages präsentiert wurden. Dabei werden wir auf die Situation und Möglichkeiten von Nachrichtenmedien zu sprechen kommen, auf den Stellenwert digitaler Kommunikation in unserem Alltag, aber auch auf unseren Umgang mit dem stetig wachsenden Datenvolumen und die Risiken und Potenziale, die damit einhergehen. Was sind die Verbindungslinien? Für uns gibt es natürlich aus wissenschaftlicher Perspektive zwei ganz wichtige Verbindungslinien: Das ist zum einen die der Kommunikation, wie wir kommunizieren in dieser Gesellschaft, die auf allen Ebenen sehr stark mediatisiert ist, und zum anderen die der Information, wie wir uns informieren. Frau Domscheit-Berg, es geht natürlich bei dieser gesamten Entwicklung zum einen um Technologien, die in einer mediatisierten Welt die Grundlage für Kommunikation und Information sind. Es geht aber zum anderen auch immer um die Aneignung dieser Technologien und ihrer tatsächlichen Nutzung. Bei der rasanten Verbreitung von Smartphones, vor allem unter Jugendlichen, und bei dem Erfolg, den digitale Mediendienste wie Facebook und viele weitere bei Nutzern jeden Alters feiern: Müssen wir in gewisser Weise den digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien vertrauen, damit Fortschritt möglich wird, damit diese Entwicklung überhaupt vonstattengehen kann?
Domscheit-Berg: Ich würde diese Annahme nicht bestätigen, weil ich sie nicht teile. Ich glaube nicht, dass Menschen nur durch den Umstand, dass sie einen Dienst nutzen, damit zum Ausdruck bringen, dass sie diesem Dienst vertrauen. Ich möchte da meinen Sohn zitieren. Er ist 15. Seit er 13 ist, wollte er eigentlich WhatsApp nutzen. Er hat sich dann aber von ganz alleine davon ferngehalten, er ist ja schließlich mein Sohn. Aber mit 14 sagte er mir eines Tages, dass er es ohne WhatsApp einfach nicht mehr länger aushalten kann: Der soziale Druck und das Ausgeschlossen-Sein waren für ihn einfach zu stark geworden. Er wusste zwar, dass WhatsApp hochproblematisch ist, weil der Dienst mit seinen Daten allen möglichen Mist anstellt. Er hatte aber nicht das Gefühl, dass er mit Blick auf sein soziales Umfeld wirklich eine Wahl hat. Die gesamte Kommunikation in der Klasse läuft darüber: Welche Hausaufgaben wie gemacht werden sollen, welche Aufgaben in der Klassenarbeit morgen dran sein könnten, wann eine Stunde ausfällt und man länger schlafen kann. Der soziale Preis des Nicht-Teilhabens war für ihn zu groß. Und das heißt mitnichten, dass er das okay findet, was WhatsApp macht. Ich denke deshalb, dass man die Verantwortung nicht einseitig auf die Nutzer abwälzen kann. Wie im Straßenverkehr brauchen wir auch bei der Nutzung digitaler Medien Regeln, die Menschen schützen, einerseits vor dem, was sie nicht wissen, aber auch vor dem, was sie meinen, auf was sie nicht verzichten können. Und wenn es dann noch um eine monopolistische Stellung geht, gibt es ja in unserem Rechtswesen so etwas wie Missbrauch einer Monopolstellung im Analogen. Warum wendet man das digital nicht genauso an? Und dann kommen wir auch zur ältesten Lüge des Internets: „Ich hab die AGB gelesen.“ Niemand liest diese Texte, weil sie einfach zu lang sind und man juristisches Fachwissen braucht, um sie zu verstehen. Da könnte man mit Regulierung etwas verändern: Ich wünsche mir eine Pflicht zu einfachen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, zum Beispiel auf einer halben Seite mit Piktogrammen, die eindeutige Bedeutungsträger sind – wie Verkehrszeichen. Die versteht man auch ohne Jurastudium und einen IQ von 120. Außerdem müsste verboten werden – genau wie man Gewinnspiele nicht an den Kauf irgendwelcher Produkte knüpfen darf –, dass Daten gesammelt werden, die für den Gebrauch einer App gar nicht nötig sind. So war es ja bei einer Taschenlampen-App, bei der man der Sammlung von Standortdaten zustimmen musste, obwohl diese für den Betrieb dieser Funktion gar nicht nötig war.
Kramp: Wie wirkt sich dieser soziale Druck, den Sie beschreiben und der durch die faktische Nutzung von bestimmten Diensten und Technologien entsteht, auf andere Bereiche wie die Nachrichtenproduktion aus? Inwiefern spielen hier auch Erwägungen eine Rolle, Nutzerdaten zu monetarisieren, Herr Döbler?
Döbler: Ich bin ja nicht für das Monetarisieren zuständig, sondern für die Inhalte, die wir auf unseren verschiedenen Kanälen – Zeitungen oder online – produzieren. Wir haben einen Dialog mit unseren Lesern, unseren Nutzern, aber wir sammeln nicht ihre Daten in dem Sinne, wie Sie es beschrieben haben. Es gibt, glaube ich, Opt-ins bei unseren Apps und nichts davon wird im direkten unmittelbaren Sinne monetarisiert. Das schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eine E-Mail von uns bekommt, auch das ist überschaubar. Ich glaube, dass das nicht unsere Baustelle ist.
Metzger: Ich teile jedes Wort, was Frau Domscheit-Berg gesagt hat, sowohl als Bürger, als auch als Medienmensch. Wie verhalten wir uns als Medienmenschen? Wir sind natürlich nicht völlig frei von Sünde, das ist ganz klar. Wenn wir Nutzer bei Bremen Vier auf Facebook verweisen, oder wenn wir Dinge über Facebook oder andere soziale Netzwerke verbreiten, dann verführen wir die Menschen im Grunde dazu, diese Geschäfts- und Nutzungsmodelle zu nutzen. Das ist also ein Teil des sozialen Drucks, den Sie gerade beschrieben haben. Was uns selbst angeht sind wir im Moment noch in der – man kann sagen entweder bedauerlichen oder komfortablen – Lage, dass wir Nutzerdaten noch gar nicht nutzen können. Wir können es nicht. Das höchste der Gefühle ist der eine oder andere Newsletter, den man bei uns bestellen kann. Ich bin beteiligt an einem Projekt, eine ARD-Mediathek der nächsten Generation aufzubauen, die personalisierbar sein soll, und da sind wir natürlich sofort im Thema. Es ist ganz klar, dass solche Dienste nur über Opt-ins funktionieren, das heißt, dass derjenige oder diejenige, die personalisieren will, einer Datennutzung ausdrücklich zustimmen muss. Und hinter dem Opt-in steht dann der Daten- und der Jugendschutz. Wir haben Datenschützer, wir haben Jugendschützer, die schauen sich alles an – und am Ende wird es so etwas wie eine ARD-Datennutzer-Charta geben, wo genau geschrieben steht, dass Daten nur für den betreffenden Zweck genutzt werden und sie jederzeit vom Nutzer wieder gelöscht werden können. So einfach wie man einsteigen kann, soll man auch wieder aussteigen können. Wir wollen gerne in diesem ganzen Spiel die Guten bleiben. Ob uns das am Ende gelingt, wird man sehen, aber die Skrupel sind groß und die Hürden sind hoch.
„Datenschutz als Wettbewerbsvorteil“
Kramp: Wenn Sie nun das Spiel zwischen ‚Gut‘ und ‚Böse‘ heraufbeschwören: Das Gros der Medienwirtschaft sorgt sich anscheinend weniger um diese Problemfragen. Nico Lumma, Unternehmen aus der digitalen Kreativwirtschaft zielen nicht selten mit ihren Geschäftsmodellen direkt auf die Auswertung werberelevanter Nutzungsdaten. Ist dieser liberalere Umgang mit digitalen Spuren ein Faktor für unternehmerischen Erfolg? Und ist die Zurückhaltung, die Herr Metzger gerade erwähnt hat, vielleicht sogar ein Wettbewerbsnachteil?
Lumma: Ja, das ist das übliche Lamento. Ich glaube es ist genau umgekehrt. Ich glaube, harter ordentlicher Datenschutz ist ein Wettbewerbsvorteil und Unternehmen aus der deutschen Werbewirtschaft, die sich daran halten und datenschutzkonform ihre Cookies platzieren, ihre Daten erheben, haben in der Tat einen Wettbewerbsvorteil, weil sie über Transparenzkriterien darlegen können, was sie sammeln, warum und wofür sie es sammeln. Ich bin zwar kein Datenschutzhysteriker, der bei jedem Cookie, der gesetzt wird, ausrastet. Das sehe ich alles relativ entspannt. Aber generell halte ich das eher striktere deutsche Datenschutzgesetz für einen großen Wettbewerbsvorteil. Weil eingangs die Frage des Vertrauens aufgeworfen wurde: Ich tendiere dazu, der Werbewirtschaft in dieser Hinsicht zu vertrauen, dass sie sich daran hält. Aber natürlich ist es auch erst mal ein Nachteil, wenn ein amerikanischer Marktteilnehmer relativ dominant ist.
Döbler: Ich glaube nicht, jedenfalls in meinem Empfinden als Nicht-Wissenschaftler – vielleicht ist es in gewisser Weise ein naiver Blick auf das Thema –, dass man diese Geschichte mit dem Datenschutz wirklich in den Griff bekommt, wenn man sich mal anschaut, was Google oder andere Unternehmen machen. Frau Domscheit-Berg hat den Fall der datensammelnden Smartphone-Taschenlampe angesprochen: Der Zweck der Taschenlampe ist es nicht Licht zu spenden, sondern Daten zu generieren. Auch der Zweck des selbstfahrenden Autos von Google ist es nicht, Mobilität zu schaffen, sondern Daten zu generieren. Also glaube ich, dass man diese Phänomene mit ein bisschen mehr oder weniger Datenschutz überhaupt nicht in den Griff bekommt. Die Wirtschaft hat sich komplett geändert, Daten sind eine Handelsware geworden und das befeuert Milliardenkonzerne. Und wer glaubt, dass er da mit einem Datenschutzbeauftragten des Landes Bremen etwas dagegen tun kann, verkennt die Lage.
„Es geht doch nach wie vor um die Inhalte von Medien und um ihre Glaubwürdigkeit.“
Kramp: Auch die Nachrichtenbranche scheint insgesamt eher in der Defensive zu sein, wenn es um die Gestaltung des Medienwandels geht. Sie reagieren mehr auf exogene Entwicklungen, als dass sie selbst Akzente setzen: Die großen Innovationen der vergangenen zehn bis 15 Jahre wurden von neuen Marktteilnehmern eingeführt: Google mit seinen Impulsen für die Informationsverwaltung und Wissensorganisation, Facebook mit seiner Vergemeinschaftungsplattform, Twitter mit seinem Kurznachrichtendienst und so weiter: alles Ideen, die auch aus Verlagshäusern hätten kommen können. Wir brauchen hier nicht diskutieren, ob der Wandel ganz konkret, was Geschäftsmodelle angeht, verschlafen wurde. Doch wie lässt sich der fortschreitende Medienwandel in Zukunft aktiv besser mitgestalten?
Döbler: Der Wandel ist ja nicht etwas, was originär Medien trifft. Es gibt andere Branchen, die viel stärker betroffen sind. Banking zum Beispiel ist quasi tot, weil es weder Zinsen, noch ein Geschäftsmodell gibt. Das Filialmodell hat sich überholt. Das heißt, die Medien sind in keiner besonderen Situation, sondern sie sind in genau der gleichen Situation wie inzwischen fast alle Branchen, dass sich nämlich die Geschäftsmodelle in den Branchen radikal ändern. Ich glaube, als Medien müssen wir auf drei Feldern Antworten haben: Die erste Antwort ist eine technologische: Ich habe keine Ahnung, wie sich die Technologien weiter entwickeln werden. Wir haben vor ein paar Jahren das iPad zum ersten Mal gesehen. Wer kann wissen, wie wir in fünf oder zehn Jahren Medien konsumieren? Vielleicht ist es ein Head-up-Display, vielleicht ist es eine Folie, auf der man irgendwas liest. Was auch immer. Die zweite Antwort betrifft die Geschäftsmodelle: Ich glaube nicht, dass sich die Geschäftsmodelle der Zukunft wesentlich von denen unterscheiden werden, die wir im Moment haben. Die Menschen werden als Nutzer oder Leser zahlen, und sie werden als Anzeigenkunden zahlen. Das sind die beiden wesentlichen Geschäftsmodelle und die funktionieren ja auch nach wie vor in allen Medienunternehmen. Die dritte Antwort betrifft die Tatsache, dass jemand, der etwas verkaufen will, auch etwas zu verkaufen haben muss. Das halte ich für den wichtigsten Punkt. Es geht also doch nach wie vor um die Inhalte von Medien und um ihre Glaubwürdigkeit. Wenn man wirklich etwas wissen will, geht man doch zu den Medienmarken. Das muss nicht unbedingt der Weser-Kurier sein, in Bremen sind es wahrscheinlich Radio Bremen und der Weser-Kurier gemeinsam, wenn es 9/11 ist, ist es vielleicht die New York Times. Aber es sind die starken Medienmarken, die die Glaubwürdigkeit haben, die viele andere Medien nicht haben. Am Ende geht es wirklich um die Frage, ob wir Inhalte liefern, die Leser und Nutzer anziehen. Und da, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren viele Fortschritte gemacht. Der Journalismus von heute ist doch ganz anders als vor 20 oder 30 Jahren. Viel innovativer, viel spannender, viel lesernäher, emotionaler. Ich kann dieses Schlechtreden einer Branche nicht mehr hören, weil es auch nicht stimmt: Die Zeitungen, die Medien sind heute besser, als sie jemals waren. Wir erreichen mehr Leser, als wir jemals hatten – aber auf verschiedenen Kanälen.
„Ich bin ... optimistisch und, was unsere eigenen Organisationen angeht, kämpferisch.“
Metzger: Ich halte den Medienwandel für eine Folge des technologischen Wandels und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Veränderungen. Ich bin deshalb überhaupt nicht pessimistisch, sondern im Gegenteil optimistisch und, was unsere eigenen Organisationen angeht, kämpferisch. Wir sind in folgender Situation, um das nochmal strukturell aufzugreifen: Wir haben viele Menschen, die, wenn sie bei der Fernbedienung auf die Eins drücken, gerne Das Erste Programm der ARD sehen wollen, wenn sie auf die Zwei drücken, wollen sie gerne das ZDF sehen und so weiter. Wenn sie im Radio auf eine bestimmte Stationstaste drücken, dann soll da bitte Bremen Eins oder Bremen Vier rauskommen. Diese Menschen sind Beitragszahler und die werden noch lange Medien so nutzen, wie sie das jetzt tun. Das ist die eine Seite und wenn wir in unseren Kreisen über Medienwandel reden, dann gibt es immer gleich diejenigen, die sagen: „Ja, ist doch alles gut, die Leute gucken doch sowieso Tagesschau.“ Es gibt aber eben auch die andere Seite und das ist genau das, wofür wir in unseren Organisationen auch arbeiten und wofür ich persönlich kämpfe. Es verändert sich eine Menge und wir müssen diesen Wandel umarmen. Ich bin da absolut bei dem, was Moritz Döbler gesagt hat: Es passiert da ganz viel. Wir schlafen überhaupt nicht. Wir müssen nur unser Stammpublikum, unser linear sozialisiertes Publikum weiter gut bedienen. Das gehört zu unserem Auftrag und wir müssen darüber hinaus – und das nach Möglichkeit mit dem gleichen Geld, weil es seit Jahren keinen Cent zusätzlich gibt – neue Publika, neue Vertriebswege, neue journalistische Formen ausprobieren. Und genau das tun wir. Deswegen bin ich überhaupt nicht pessimistisch, sondern glaube, dass in dem Maße, wie da neue Publika heranwachsen, wir auch Antworten darauf finden werden, wie wir sie erreichen. Das ist in unserem öffentlich-rechtlichen Sektor immer ein bisschen zäh. Über das junge Angebot von ARD und ZDF reden wir jetzt auch schon eher vier Jahre oder fünf, als zwei. Ich bin relativ überzeugt, dass wir damit im Rahmen unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags, junge Menschen erreichen werden. Da muss man auch manchmal den Kolleginnen und Kollegen ein bisschen einen Schrecken einjagen. Generationsabriss ist ja so ein Schlagwort. Ja, wir müssen uns bewegen, das ist die Botschaft nach innen. Aber wir bewegen uns und bisher ist uns noch eine Menge guter Dinge eingefallen.
„Mein Sohn kriegt sogar hochgradig politische News, die schaut er bei LeFloid auf YouTube“ oder „Wir haben nicht zu viele Informationen, wir haben ein Filterproblem!“
Domscheit-Berg: Ich muss nochmal meinen Sohn zitieren – das wird ihn wahrscheinlich freuen, wenn ich das später erzähle – aber das einzige, was er öffentlich-rechtlich schaut, ist Die Anstalt und die schaut er im Internet nicht mit der Fernbedienung, sondern mit der Tastatur. Ich habe den Fernseher so zwei bis drei Jahre vor seiner Geburt abgeschafft und ich dachte, wenn er dann in den Kindergarten kommt, alle von den gleichen Filmchen erzählen und er eines Tages nach Hause kommt und sagt, dass er auch einen Fernseher haben will, ich klein beigebe und wieder einen anschaffe. Ich warte noch heute auf den Tag. Mein Sohn kam in 15 Jahren nicht ein einziges Mal und hat gesagt, dass er einen Fernseher haben möchte. Es spielt für ihn einfach keine Rolle. Das heißt aber nicht, dass er nicht an Tagesnachrichten interessiert ist. Er bekommt seine News, er kriegt sogar hochgradig politische News, die schaut er bei LeFloid auf YouTube, wie ganz, ganz viele andere aus seiner Generation auch. Das ist auch ein Nachrichtenkanal, wenn auch nicht die Tagesschau. Man kann jetzt sagen, die Leute werden noch ganz, ganz lange bestimmte traditionelle Kanäle benutzen – das mag sein. Die Lebenserwartung liegt zurzeit bei circa 81, glaube ich, aber irgendwann ist es eben doch vorbei. Man muss sich eben auch ein bisschen intensiver mit denen befassen, die andere Wege benutzen. Ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist, aber er ist halt noch im Bahnhof. Herr Döbler, Sie haben gesagt, die Geschäftsmodelle werden sich nicht so wesentlich verändern, die Leute werden für das Lesen bezahlen. Das glaub ich auch. Ich glaube aber, dass sie es auf einer ganz anderen Art tun werden. Ich habe zwar noch ein Zeitungs-Abo, aber der Stapel wird in der Ecke der Küche immer größer und es gibt Ärger mit dem Ehemann über diese ungelesenen Zeitungsstapel. Was ich mit meinem Lebensstil eigentlich brauche – und ganz viele machen das so ähnlich – always on: ich will gar nicht nur die News oder Informationen von einem Medium, ich will die von ganz vielen Medien haben und zwar zu meinen spezifischen Interessensgebieten, die völlig anders sein können, als das, was Sie interessiert. Ich möchte, dass quasi in Realzeit ein Programm für mich zusammengestellt wird. Da gibt es etliche neue Entwicklungen auf dem Markt. Zwar wird immer wieder von einer Informationsflut gesprochen, doch wir haben nicht zu viele Informationen, wir haben nur ein Filterproblem. Daher gibt es viele praktische Start-ups, die mir ermöglichen, mir selber einen Filter so genau feinzustellen, dass der meinen Bedürfnissen am besten entspricht. Um solche Filter benutzen zu dürfen, bezahlen dann Leute auch Geld. Also beim Start-up piqd muss man für das Gefiltere eine Monatsgebühr von drei Euro zahlen. Ich filtere da zum Beispiel mit und erkläre den anderen Nutzern, warum sie welche Texte lesen sollten. Bei dem Artikel-Kiosk Blendle funktioniert das anders. Das ist im Prinzip ein Micropaymentsystem. Da sind nicht nur Artikel verfügbar, die sonst hinter Paywalls versteckt sind, da sind tatsächlich auch Artikel verfügbar, die man anderswo kostenfrei lesen kann. Aber Menschen lesen sie für Geld auf Blendle, weil sie eigentlich ganz froh darüber sind, dass sie auch mal was bezahlen können. Das ist nämlich auch eigentlich eher ein Vorurteil, dass alle – insbesondere junge Leute – alles immer nur umsonst wollen. Was viele Menschen auch nicht wissen ist, dass noch keine jüngere Generation so viel Geld für Medien, Kulturen, Informationen bezahlt hat wie die heutige. Das ist nicht die Raubkopierer-Generation, sondern die Viel-Bezahler-Generation. Das sollte man ehrlich mal ansprechen.
Döbler: Ich bin völlig bei Ihnen. Klar, in die Richtung geht das. Es muss bloß so sein, dass Journalismus – und der ist, glaube ich, schon etwas wert – auch am Ende bezahlt werden kann. Die Nachrichtenagentur Reuters war an dem Abend der Terroranschläge in Paris, mit 100 Leuten vor Ort. Die müssen alle erst einmal bezahlt werden. Ich bin völlig bei Ihnen, dass Leser zukünftig anders für das zahlen werden, was sie lesen, aber es muss halt schon ausreichend bezahlt werden.
„Ich habe vier Kinder und wenn ich mir anschaue, wie sie die Medien nutzen: ja, meine Güte!“
Lumma: Also das Spannende ist ja – wenn die Frage ist: „Haben die Verlage den Wandel verschlafen und hecheln jetzt hinterher?“ –, dass die Innovation immer am Rande entsteht. Es gibt ganz selten mal einen Fall, dass so etwas wirklich von vornherein im Mittelpunkt steht und dann alle sagen: „Wow, es hat funktioniert!“ Und was ich eben feststelle, sind viele hochspannende, neue Entwicklungen, bei denen die Frage im Mittelpunkt steht: Wie kann man Journalismus refinanzieren? Wie kann man Angebote so zusammenschneiden, dass Leute sie wieder lesen, also auf unterschiedlichsten Touch Points? Es kommen immer mehr und mehr dazu. Was passiert auf der Apple Watch? Was passiert auf dem Head-up-Display? Da ist eine riesige Bewegung am Markt, was ich persönlich total spannend finde, weil eben nicht mehr die Frage im Vordergrund steht: „Paywall oder Werbung“, sondern wir jetzt eben auch neue Formen der Refinanzierung von journalistischen Angeboten finden. Wenn wir unsere Kinder zitieren, dann muss ich erwähnen, dass ich zuhause mit viel sozialem und persönlichem Engagement ein echtes Labor für Medienwandel eingerichtet habe: Ich habe vier Kinder und wenn ich mir anschaue, wie sie die Medien nutzen: ja, meine Güte! Also YouTube ist ja schon was für die Älteren. Snapchat nutzen sie den ganzen Tag lang, mit Inhalten die vergänglich sind. Wie geht man damit um, wenn man dort präsent sein will mit einem Artikel, der wieder verschwindet? Das ist gerade eine wirklich irre Zeit. Medienhäuser haben lange mit dem Schritt von Print zum Web gehadert. Und jetzt fangen auf einmal alle an, auf diesen kleinen Smartphones herumzulesen. Die Fragestellung ist ja: „Wie monetarisieren wir das? Wie funktioniert die Werbung darauf? Funktioniert sie überhaupt? Und welche Werbung muss es sein?“ Ich sehe da nicht eine Branche, die sich zurücklehnt und denkt, dass alles wieder verschwinden wird, sondern es sind alle an vielen Ecken aktiv und entwickeln neue Formate.
Döbler: Also die anekdotischen Erzählungen von Kindern und Jugendlichen sind prima, ich glaube bloß, dass wir auch vor 20 Jahren keine Zehn- und Fünfzehnjährigen mit Zeitungen erreicht haben. Es ist nett, wenn Kinder und Jugendliche auch mal in die Zeitung schauen oder uns auf dem iPad lesen, aber das ist doch nicht das Ziel! Das Ziel sind die Erwachsenen; das Ziel ist Anspruch. Junge Erwachsene werden vielleicht auch nicht mit 18 plötzlich zum Zeitungsleser, aber sie werden es möglicherweise, wenn sie sich in Bremen oder in der Region informieren wollen. Dann werden sie auf irgendeinem Weg zu Inhalten kommen, die Radio Bremen oder der Weser-Kurier machen. Und sie werden vielleicht, wenn sie 30 sind und eine Familie gründen und irgendwo mitreden wollen, auch das Medium nutzen, vielleicht nicht auf dem Kanal, den wir kennen, oder den wir seit dem 18. Jahrhundert betreiben, vielleicht nicht auf Papier, aber an den beiden Marken geht doch in der Region kein Weg vorbei.
Kramp: Wir konnten natürlich noch nicht einmal annähernd alle interessanten Aspekte, die wir heute im Laufe des Tages diskutiert haben, ansprechen, aber jetzt haben wir die Gelegenheit, dies noch nachzuholen. Ich möchte die Runde nun gerne öffnen. Bitteschön!
„Alle diese Kanäle haben auch eine Art Überraschungsschublade.“
vom Lehn (Publikum): Ich habe ein massives Problem damit, wenn jemand sagt, er brauche nur die Informationen, die ihn interessieren, und dafür möchte er auch bezahlen und alles andere blendet er aus. Das kann man machen, okay, aber ich hätte die große Sorge, dass man dann irgendwann zum Fachidioten wird. Ich finde es schade, überhaupt nicht Zeitungen von vorne bis hinten durchzublättern, sich anregen zu lassen und auch mal über den Tellerrand in andere Themengebiete zu schauen. Auch wenn ich nicht vom Wirtschaftsfach bin, sollte ich mich vielleicht dafür interessieren. Ich werde viel stärker dadurch angeregt, mich auch mit diesen Themen zu beschäftigen, wenn ich diese Zeitung komplett vor mir habe, als wenn ich gleich eine gefilterte Ausgabe im Netz habe. Das empfinde ich nach wie vor als riesigen Vorteil einer qualitativ hochwertigen Zeitung.
Domscheit-Berg: Ich habe natürlich mehr als einen Kanal, über den ich mich informiere und wer mich kennt, weiß, dass ich zum Beispiel Twittersehr stark benutze und zwar nicht nur zum Senden, auch zum Empfangen. Und da kommen mir ganz, ganz viele Dinge jenseits meiner vielleicht klassischen und überschaubaren Interessensgebiete reingespült, wo ich durchaus jede Menge Anregungen kriege und auch Überraschungsfunde habe. Aber selbst Kanäle wie Blendle oder piqd haben ja nicht nur Kanäle wie Technologie oder Politik, Feminismus und was auch immer einen so interessieren könnte, sondern sie alle haben auch eine Art Überraschungsschublade, in der man natürlich immer wieder Neues findet. Ich habe festgestellt, dass ich – also ich bin Abonnentin der taz – wenn ich die taz mal durchblättere, ich bei Artikeln gar nicht unbedingt auf die Schlagzeile schaue, sondern auf den Autor. Das entscheidet für mich dann, ob ich den Artikel lese oder nicht, weil ich meine Lieblingsautoren habe. So kann ich bei Blendle zum Beispiel einstellen, dass ich in meine Schublade alle Texte von Autor X bekomme und zwar unabhängig davon, worüber die Person gerade schreibt. Meinem Medienkonsum entspricht das sehr stark. Wir haben heute einfach mehr Möglichkeiten. Man kann ja auch weiterhin Die Zeit von vorne bis hinten lesen, damit ist man dann eine Weile beschäftigt, aber für mich ist das keine Option mehr.
„Wir werden bezahlt für das, was die Leute von uns nicht erwarten.“
Döbler: Ich würde gerne ein Beispiel dazu bringen: Wenn Sie vor zwei, drei Monaten jemanden in Bremen gefragt hätten: „Sag mal, möchtest du eigentlich endlich mal wieder eine Geschichte über Griechenland lesen?“ wäre wahrscheinlich die Antwort bei den meisten gewesen: „Nein, davon habe ich eigentlich genug gelesen, interessiert mich nicht.“ Wir hatten das Gefühl, dass man trotzdem immer nur das Gleiche liest und haben deswegen zwei Reporterinnen, zwei junge Frauen, nach Griechenland geschickt. Und die haben sich da umgeschaut und eine Reportage mitgebracht. Und zwar eine, die wir auf acht Seiten gemacht haben, also ein richtig dickes Pfund. Ein Acht-Seiten-Text mit einigen Bildern. Das macht eine Regionalzeitung. Was passiert? Es passiert, dass das unsere bestverkaufte Sonntagsausgabe aller Zeiten ist, im Einzelverkauf plus 18 Prozent. Das ist das Anspruchsvolle, der Versuch eine Geschichte anders zu erzählen – und das ist kein Autor, den Sie kennen und kein Thema, das Sie vorher interessiert hat – und so aufzubereiten, dass es tatsächlich eine Wirkung erzeugt. Ich glaube, das ist es, was wir auch als Medien, als Zeitung besser können als andere. Ich sage meiner Redaktion häufig: „Wir werden nicht für das bezahlt, was die Leute von uns erwarten, sondern genau das Gegenteil. Wir werden bezahlt für das, was die Leute von uns nicht erwarten, die überraschende Perspektive, den interessanten Einblick, die andere Präsentation.“ Das Erwartbare, das ist gratis, aber das Nicht-Erwartete, das Besondere, das kostet Geld und dafür gehen wir auch nicht zu Blendle, diese acht Seiten die gibt’s nur, wenn man den Weser-Kurier kauft, sonst nicht.
Domscheit-Berg: Blendle ist bezahlt, das wissen Sie schon?
Döbler: Ja, wie viel denn? 10 Cent oder sowas.
Domscheit-Berg: Das stimmt nicht, also der Spiegel stellt da Artikel für knapp zwei Euro ein. Den Preis können die Anbieter selbst bestimmen. Die billigsten Artikel kosten tatsächlich 10 Cent, die meisten so um die 50 Cent und es gibt ganz viele für circa 99 Cent. Es gibt aber auch längere, gute Geschichten, die man dann bekommt. Ich hab ja Politik abonniert, ich hätte den bekommen, wenn die in der Kategorie Unsere Kuratoren empfehlen heute folgende Texte erscheinen. Da würde so ein herausragender Text wahrscheinlich immer auftauchen, der würde an mir wahrscheinlich gar nicht vorübergehen. Ich habe ihn aber nie gesehen, weil ich in Brandenburg niemals den Weser-Kurier lesen würde und auch keinen kenne, der den liest. Aber über Blendle würde der bei mir plötzlich auftauchen, obwohl der Weser-Kurier sonst für mich ganz weit weg ist, einfach weil er eine herausragende Geschichte zu einem interessanten Thema hat und das bemerkt wird. Insofern wäre das für Sie eine Chance, Leser zu erreichen, die außerhalb Ihres Einzugsbereichs sind und von denen sogar Geld zu bekommen, das nennenswert ist.
Döbler: Okay, dann haben wir einen zusätzlichen Vertriebskanal, das ist gut.
„Wir müssen uns als Massenmedien überlegen, wie breit oder wie spitz wir uns positionieren.“
Publikum: Ich denke auch, dass man viele verschiedene Vertriebskanäle nutzen sollte. Wer das vormacht, ist die Filmindustrie. Sie hat es schon immer geschafft, ganz viele verschiedene Vermarktungskanäle zu nutzen: Kino, Fernsehausstrahlung, DVDs, Streaming. Das ist alles sehr gut organisiert, wie man auf verschiedenen Plattformen doppelt, dreifach, vierfach das Geld einnimmt und das auch sehr stark differenziert nach unterschiedlichen Zielgruppen. Ein Jugendlicher wird in seinem ganzen Leben niemals 1,99 Euro für irgendeinen Spiegel-Artikel ausgeben, weil die einfach für andere Sachen schon sehr viel Geld ausgeben, für Streaming-Dienste oder für ihr Handy, für ihre Datenflatrates. Nochmal zum Thema: Es ist ja schön, dass Sie Blendle für sich entdeckt haben. Ich glaube, das ist ein Trend, der sich hier schon in den letzten zehn Jahren entwickelt hat – über RSS Feeds und Digg und Reddit –, so dass sich das Interesse an aktualisierten und sehr spezialisierten Diensten verstärkt hat. Und natürlich kann man auch mal die Zeitung durchblättern und dann so wahnsinnig tolle Sachen über irgendwelche Kaninchenzuchtvereine und sonstige Sachen erfahren, die man sonst nie so gelesen hätte. Aber wenn Sie sich mal Jugendliche anschauen, die wollen extrem tiefgehende Informationen zu ihren sehr idiosynkratischen Interessen haben und wir haben jetzt die Chance, dass da tatsächlich ein Medium ist, dass das bietet. Ich baue mir natürlich auch meine eigene Zeitschrift und Zeitung zusammen und gehe in bestimmte Themenfelder extrem tief hinein. Dann langweilt es mich, wenn die Süddeutsche nach einer Woche oder Die Zeit nach vier Wochen oder manchmal nach drei Monaten so ein Thema entdeckt hat. Das ist alles im primären Webmedium schon viel weiter. Ich bin prinzipiell auch dafür, dass es Journalisten gibt, die in Paris herumlaufen und dafür bezahlt werden, dass sie darüber berichten. Aber da muss man sich halt auch überlegen, wie man es im Endeffekt vielleicht anders bezahlen kann.
Metzger: Das führt ja zu der dahinterliegenden interessanten Frage, ob allgemeine Mainstream-Medien in diesem Medienwandel langfristig eine Chance haben oder nicht. Ich drehe es mal um: Ich glaube, dass Medien wie die unseren, die spezialisiert sind, weil sie eine Dienstleistung für eine Community anbieten, also der Weser-Kurier oder Radio Bremen für das Land Bremen, Bremen, Bremerhaven und umzu, dass die mit dieser Spezialisierung eine glänzende Zukunft haben. Kaninchenzüchterverein klingt so ein bisschen herablassend oder abschätzig, nehmen wir das mal als Chiffre für „Was ist los, um mich herum? Was muss ich wissen und verstehen in meiner Community? Was sind relevante Prozesse und Personen, die mich angehen, die ich möglicherweise auch in zwei Jahren wieder wählen soll oder nicht?“ Wir sind die Spezialisten für das Regionale. Ich glaube, dass das eine glänzende Zukunftsperspektive ist, so wie andere Leute glänzende Zukunftsperspektiven haben, wenn sie meinetwegen ein europäisches Politico in Brüssel gründen oder andere spezialisierte Dienste. Wir müssen uns als Massenmedien überlegen, wie breit oder wie spitz wir uns positionieren. Und ich bin davon überzeugt – was uns, sozusagen die alten Medien, angeht –, dass wir mit einer Spezialisierung auf die Region mit einer Dienstleistung für unsere Gemeinschaft, die uns trägt und am langen Ende ja auch bezahlt, in Zukunft weiter sehr gut fahren werden, wenn wir diesen Auftrag erfüllen.
Bänsch (Publikum): Ich habe das Gefühl, wir machen heute schon den ganzen Tag einen Spagat zwischen Pessimismus und Optimismus. Bei Ihnen vieren hab ich jetzt das Gefühl, dass es prinzipiell optimistisch ist. Es klingt für mich so, als ob schon alles okay sein wird. Widersprechen Sie mir, wenn das nicht so ist. Deswegen meine Frage: Wovor haben Sie denn Angst? Was sind denn die Herausforderungen? Was ist gruselig für Sie, wenn wir an die Zukunft der Medien und der digitalen Medien denken?
Lumma: Also gruselig ist ja per se erst einmal nichts. Das ist ja gerade das Spannende. Es kommen so viele neue Sachen, da ist immer etwas zu tun. Wenn wir über lokal und regional sprechen, dann können wir auch über hyperlokale Perspektiven reden, wo immer noch nicht der Stein der Weisen gefunden wurde. Es gibt noch so viele Herausforderungen, das ist doch wundervoll, da ist doch nichts gruselig dran.
„Ich weiß von damals, dass es unschuldige Information nicht gibt.“
Domscheit-Berg: Naja, also ich find schon ziemlich viele Dinge ziemlich gruselig. Ein paar davon sind schon im Laufe des Tages angesprochen worden. Ich komme aus der DDR. Ich habe Angst und zwar ganz real vor einem digitalen Totalitarismus und halte den nicht für eine Horrorvision, sondern durchaus für ein mögliches Zukunftsszenario. Ob wir dahin kommen oder nicht, ist eine ganz andere Sache, wird aber davon abhängen, ob wir etwas dagegen tun oder nicht. Also im Moment sind wir in einem Boot, das sich in einem Fluss bewegt, der einen gewissen Strom hat. Wenn wir nichts dagegen tun und rückwärts rudern, dann geht es in diese eine Richtung. Es gibt ganz viele Entwicklungen, die erleichtern, dass Geheimdienste eine neue Daseinsberechtigung brauchen, oder die technologische Phänomene wie das Internet der Dinge ermöglichen. Ich finde das total faszinierend, dass man Straßenlampen heute mit Bewegungssensoren ausstatten kann und die das Licht dann immer nur dann hochdrehen, wenn ein Mensch vorbeigeht, und vor einem immer so eine kleine Lichtwand aufgeht und dann geht es wieder aus. So kann man 80 Prozent Strom sparen – ist total toll. Aber wenn da jetzt jemand noch eine Gesichtserkennungssoftware mit verknüpft und eine Kamera mit artificial intelligence ergänzt, dann kann diese Straßenlampe jemand anderem erzählen, dass Anke da gerade um 23:42 Uhr lang geht. Das ist dann schon gruselig. Damit meine ich nicht irgendeinen Typen, der plötzlich hinter dem nächsten Busch hervorspringt, sondern Dinge wie Bewegungsprofile. Irgendwann lässt sich damit verknüpfen, welchen Blutzuckerspiegel ich habe und welche Präferenzen, welche Ängste und Leidenschaften, welche Beziehungsnetze, wofür ich viel oder wenig Geld ausgebe. Das sind ausführlichere Profile, die ein genaueres Bild über mich ergeben, als ich es selber von mir habe. Ich war 21, als die Mauer fiel. Ich war in der Opposition als Studentin sehr aktiv, habe die Stasi also noch aus persönlicher Erfahrung kennen gelernt und ich weiß von damals, dass es unschuldige Information nicht gibt. Es hängt immer vom Kontext einer Information ab und sie kann gegen einen verwendet werden, egal was es ist. Bei mir damals hat die Stasi versucht, mich zum IM zu erpressen, mit der simplen Information, dass sie wussten, dass mein Vater Alleinverdiener und städtischer Angestellter ist. Die haben gesagt: „Willst du, dass Papa die Familie weiter ernähren kann? Ja oder nein? Dann musst du für uns arbeiten.“ Das war die Drohkulisse. Sie haben aber auch gleichzeitig gewusst, dass ich gerne französisch spreche und gerade einen Wettbewerb Französische Sprache für eine Pariser Kunstschule gewonnen hatte, ich wäre also als einzige DDR-Studentin für drei Monate nach Paris gegangen. Kann sich kein Wessi vorstellen, was das bedeutet. Das ist ungefähr Tausendundeine Nacht mal 1000, war also komplett unvorstellbar großartig. Dann erzählt mir der Typ, wie toll La Tour Eiffel und Les Champs-Élysées sind, aber ich darf nur mit, wenn ich als IM für sie arbeite. Also diese harmlose – vermeintlich harmlose – Information „Anke findet französisch toll, darf nach Paris, da kommt man nicht so leicht hin“, die wurde plötzlich gegen mich verwendet. Das heißt, in einem bestimmten Kontext kann ich mit Informationen, die sehr persönlichen Charakter haben, ohne dass sie besonders privat sind, Menschen manipulieren, ich kann sie erpressen, ich kann sie steuern und das ist alles für mich nicht vereinbar mit einer Demokratie. Deswegen klinge ich auch wahrscheinlich gerade jetzt ein bisschen emotional berührt. Ich habe davor Angst und ich will das nie wieder erleben. Ein totalitäres System, das totalitäre Methoden einsetzt, ist ja irgendwie wenig überraschend. Aber warum eine Demokratie Methoden eines totalitären Staates einsetzt, erschließt sich mir nicht und ist für mich dann in dem Moment auch keine echte Demokratie mehr. Deswegen müssen wir dagegen in der Tat etwas tun.
„Es ist maßlos. Es ist radikal. Es ist immer wütender.“
Döbler: Ich würde alles, was Sie gesagt haben, unterschreiben. Ich habe trotzdem andere Ängste. Vor der Technologie habe ich überhaupt keine Angst. Ich glaube, bei der Gestaltung von Journalismus bietet sie viel mehr Chancen als Risiken in unserem professionellen Umfeld. Ich habe auch, ehrlich gesagt, wirtschaftlich keine große Angst. Wenn Sie ein kleines Rechenexempel mit mir machen: Wir verlangen pro Zeitung pro Tag ungefähr einen Euro, wir haben ungefähr 150.000 Leser, also allein aus den Lesern haben wir pro Tag 150.000 Euro Umsatz, das ist ganz ordentlich. Und der Anzeigenumsatz kommt hinzu. Also wenn man daraus nichts machen kann, dann weiß ich es nicht. Natürlich haben wir ein gutes Geschäftsmodell, nach wie vor. Inhaltlich denke ich, dass es gerade für regionale Medien große Chancen gibt, weil sie eben einen USP haben, ein Alleinstellungsmerkmal, den zum Beispiel die FAZ oder der Stern oder wer auch immer nicht hat. Erklären Sie mir, was der Stern ist, darüber können wir lange diskutieren. Erklären Sie mir, was der Weser-Kurier ist, wofür der steht, das ist relativ schnell erzählt. Was die Ängste sind, merke ich in Reaktionen auf das, was wir machen. Wie Leser und Leserinnen, Nutzer und Nutzerinnen auf das reagieren, was wir machen, hat sich total verändert. Es ist maßlos. Es ist radikal. Es ist immer wütender. Die Leute sagen in Mails und in Kommentaren Dinge, die sie nie jemandem ins Gesicht sagen würden. Es ist ein Ton, der sich total verändert, der mich auch manchmal ratlos zurücklässt. Die Leute wissen es immer alle gleich ganz genau, das geht mir am meisten auf die Nerven. Davor habe ich Angst, dass etwas passiert und sofort ist ganz klar, was dahinter steckt, es gibt keinen Zwischenton, es gibt keine Skepsis und es gibt nicht das Gefühl: „Jetzt lass uns mal schauen, wie wir das aufklären“, sondern es ist immer gleich mit 150 Prozent Meinung. Das ist manchmal auch verletzend. Es ist manchmal richtig hasserfüllt. Ich habe heute einen Leserbrief eines älteren Herren beantwortet – und das schlägt sich eben auch in dieser Form des Dialogs nieder, nicht nur im Internet –, der von „Ihren bescheuerten Bildchen“ geschrieben hat. Da hat sich etwas verändert und das finde ich unangenehm.
„Ich habe auch gelegentlich Angst, was die Veränderung von Öffentlichkeit angeht.“
Kramp: Haben Sie Angst, Herr Metzger?
Metzger: Manchmal schon, aber meistens nicht in meinem Beruf. Ich habe manchmal Angst, dass wir zu langsam sind, dass unsere Organisationen zu behäbig sind, zu sehr im Jetzt verhaftet und zu wenig Lust auf Veränderungen haben. Das ist natürlich auch eine Typenfrage, da gibt es solche und solche. Ich versuche da, wo ich arbeite, zu befördern, dass die Leute Lust auf Veränderungen haben und die Chancen eher sehen, als die Komfortzone, in der wir gerade sind oder die Bequemlichkeit des Status quo. Ich habe – um an Moritz Döbler anzuknüpfen – auch gelegentlich Angst, was die Veränderung von Öffentlichkeit angeht. Ich will das mal anekdotisch berichten: Das Erste hat einen Programmbeirat. Das ist ein relativ großer Kreis honoriger Damen und Herren, alle hoch gebildet, die den Auftrag haben, Das Erste zu beobachten und dem Programmdirektor und dem Chefredakteur regelmäßig Feedback zu geben. Eine wilde Debatte über die Ukraine-Berichterstattung. Nur gibt es keine Berichterstattung, die fehlerfrei wäre und auch die Ukraine-Berichterstattung war dies gewiss nicht. Nur das, was dem Ersten da vorgeworfen wurde, das ging weit über kleine sachliche Fehler hinaus. Dann fragt man sich, wie kommt so eine Stimmung zustande. Das ist zum Teil das Maßlose, es ist zum Teil aber auch bewusste politische Einflussnahme über soziale Medien gewesen. Wir wissen, das ist sozusagen psychologische Kriegsführung, dafür gibt es ja Handbücher, wir können ja nachlesen, dass es Leute gibt, die in diesem Fall im Auftrag der russischen Regierung die deutsche öffentliche Meinung über Blogs und alles Mögliche beeinflusst haben. Dass so etwas passiert, das ist klar. Das ist auch schon immer passiert, es passiert heute mit anderen Mitteln, aber dass das so hineinwirkt auf – in diesem Fall – Aufsichtsgremien der ARD, die davon natürlich beeinflusst werden, also dass sozusagen – um es jetzt mal sehr plastisch zu sagen – der russische Geheimdienst einen indirekten Zugriff auf das Erste Deutsche Fernsehen auf diese Weise bekommt, das finde ich – und das hat mit neuen Mechanismen zu tun, die da wirken – besorgniserregend. Es ist ganz schwer, diese Debatte zu führen, weil jeder der da sagt, „ihr habt das schlecht gemacht“, der wird natürlich nicht sagen, „das habe ich von irgendeinem russlandfreundlichen Troll“, sondern „das habe ich irgendwo gelesen.“ Das ist doch auch so. Da verändert sich also etwas und das geht bis in kommerzielle Strukturen hinein. Neulich ist eine österreichische Marketingagentur gerügt worden, die in sozialen Medien sozusagen Pseudo-Blogs aufgemacht hat, um Produktinformationen zu beeinflussen. Die stellen dann Leute ein, die Produkte toll finden und so tun, als seien sie Nutzer dieser Produkte. Da verändert sich etwas in der Öffentlichkeit, was dann natürlich auch auf uns und auf die Medien wirkt. Das ist nicht lustig.
Neuberger (Publikum): Herr Döbler und Herr Metzger haben ja die Zukunft ihrer Medien als sehr rosig, als sehr glänzend dargestellt, möglicherweise sind der Weser-Kurier und Radio Bremen wirklich Ausnahmen der Medienlandschaft. Die Ergebnisse der Publikumsforschung, die für die Gattung insgesamt sprechen, weisen doch etwas anderes aus. Die Allensbacher Werbeträger-analyse sagt zum Beispiel, dass nur noch 27 Prozent der 14- bis 29-Jährigen die Tageszeitung zur Hand nehmen. Die Erwartungen, die Sie gerade geäußert haben – wenn sie älter sind, fangen sie dann an Zeitung zu lesen –, sind sehr eindeutig widerlegt. Das ist ein Kohorteneffekt. Wer nicht in jungen Jahren anfängt, die Tageszeitung zu lesen, wird es später auch nicht mehr machen. Bei den Öffentlich-Rechtlichen wissen wir, dass es einen deutlichen Generationsabriss gibt. Das Durchschnittsalter beim ZDF-Publikum liegt bei über 60 Jahren, aber auch im Hörfunk liegen die Durchschnittswerte relativ hoch. Auch da – das zeigt die Langzeitstudie Massenkommunikation bei der jungen Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen – gibt es eine ganz deutliche Umschichtung im Mediennutzungsverhalten weg von den alten Medien Fernsehen, Hörfunk und Zeitung und ganz eindeutig hin zum Internet mit mittlerweile über drei Stunden täglicher Nutzung. Das sind zunächst mal Dinge, die man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen muss. Das betrifft die Gattung insgesamt. Es mag Ausnahmen geben, hier in Bremen. Was die Refinanzierung angeht, wissen wir, dass es erhebliche Probleme im Internet gibt. Auch die AWA sagt, dass nur vier Prozent der Bundesbürger bisher bereit waren, für digitale Produkte der Tageszeitung zu zahlen. Da sind ganz offensichtlich ganz erhebliche ökonomische Probleme, aber auch Probleme, was die Identität des Journalismus angeht, die Abgrenzung vom Journalismus zum ganzen Rest. Da scheinen mir die Konzepte der alten Medien bisher nicht wirklich ausgereift zu sein, obwohl dieses Medium mittlerweile 20 Jahre existiert und Zeit genug gewesen wäre, sich da etwas einfallen zu lassen.
„Wir sind ganz am Anfang und niemand hat die Rezepte.“
Metzger: Also das letzte, bei allem Respekt, halte ich für vermessen. 20 Jahre ist das Medium schon da und wir wissen, wo es hingeht und welche Auswirkungen es hat. Das können Sie nicht wirklich ernst meinen. Wir sind so am Anfang dieser Entwicklung und wenn ich wüsste, wo es hinginge, dann wäre ich Berater und nicht hier und würde wissenschaftliche Referate halten. Die Analyse, dass sich etwas erheblich verändert, teile ich vollkommen. Unsere Aufgabe besteht darin, mit diesen Veränderungen umzugehen. Ich bin der Erste, der das unterschreiben würde, dass wir nicht perfekt sind und dass alles schneller gehen könnte. Aber sie bewegt sich doch. Ich habe den Eindruck, dass bei uns der Start von Netflix in Deutschland ein Schuss gewesen ist, den ganz viele gehört haben. Bis vorletzten Sommer haben wir häufig relativ fruchtlose Debatten im Kreis der Intendantinnen und Intendanten geführt, weil, wenn man mit den Themen „Veränderte Mediennutzung“, „Was machen eigentlich die Jungen?“, „Wie kriegen wir die?“ anfing, dann wusste man schon, wer sagen würde: „Ja, aber sie gucken doch immer noch die Tagesschau“. Seit Netflix im vorletzten Sommer kam, hat sich die Gewichtung dieses Themas erheblich verschoben. Wir sind sicherlich nicht die schnellsten, wir sind manchmal eher ein bisschen gründlicher als schnell, aber ich bin da überhaupt nicht pessimistisch. Ich will es noch einmal von der anderen Seite sagen: Wir haben das Privileg der Beitragsfinanzierung. Wir müssen uns nicht sofort mit jedem Sendeplatz refinanzieren, wie die kommerzielle Konkurrenz das zum Beispiel muss. Wer, wenn nicht wir, soll in der Lage sein, auf diesen Wandel zu reagieren? Und wir machen das mit Radio-Programmen, mit Fernsehprogrammen, wir versuchen herauszufinden, wie wir diese Marken – es sind nicht besonders viele, die sehr stark sind – in das Internet hineinverlängern. Aber das ist alles natürlich auch Versuch und Irrtum. 20 Jahre Internet; wir sind ja beide noch jung, lassen Sie uns in 40 Jahren mal darüber reden, was sich dann getan hat. Wir sind ganz am Anfang und niemand hat die Rezepte.
Döbler: Ich glaube, Sie haben mich falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, wer nie Zeitung gelesen hat, wird dann plötzlich mit 30 Jahren das Print-Abo abschließen, das glaube ich auch nicht. Ich bin aber auch nicht in der holzverarbeitenden Industrie, sondern mir geht es darum, dass jemand, der in Bremen mitreden will, am Weser-Kurier nicht vorbeikommt, egal auf welchem Medium oder Weg er zu uns kommt. Und, ehrlich gesagt, habe ich wirklich keine Ahnung, was wir in zehn Jahren für Kanäle haben. Aber mein Interesse, mein Ansporn, mein Ziel ist, dass wir die Inhalte haben, die, auf welchem Kanal auch immer, Geld wert sind. Darum geht es uns. Was wir zunehmend merken, ist, dass die alte Strategie der Zeitung: „Wir stellen ins Netz, was wir in der Zeitung haben“, Quatsch ist. Wir müssen Dinge machen, die dies ergänzen. Ich habe unsere Griechenland-Reportage erwähnt. Die haben wir nicht ins Netz gestellt, sondern andere Reportagen aus Griechenland mit eigenen Filmen, mit Bildern, mit Geräuschen. Wenn man diese Multimedia-Reportage anklickt, hört man griechische Zikaden. Es ist wunderschön, richtig rührend, es ist aber etwas ganz anderes als in der Papierzeitung. Da liegt auch ein bisschen die Chance, dass man Komplementärinhalte entwickelt. Vermarkten lässt sich das im Internet im Moment aus unserer Sicht nahezu nicht. Es gibt kein Geschäftsmodell für uns, das sich selbst tragen würde. Das wird auch noch auf lange Sicht so bleiben. Ich habe Ihnen die Zahlen eben vorgerechnet. Ich bin sicher, dass wir noch mindestens die nächsten zehn Jahre ganz überwiegend unsere Umsätze im Printbereich generieren werden und auch müssen. Es gibt keine Refinanzierung im Internet für journalistische Inhalte. Es gibt ganz wenige Beispiele, die funktionieren. Wir werden versuchen müssen, die Inhalte zu gestalten, die was wert sind. Dann wird man sehen, auf welchem technischen Weg diese Inhalte an die Nutzerinnen und Nutzer, an die Leserinnen und Leser kommen.
Metzger: Über die Mediengrenze hinweg nur ein Hinweis: Es gab noch nie eine Refinanzierung journalistischer Inhalte. Sie haben vorher Anzeigen verkauft. Also der Springer-Verlag macht ganz gut vor, wie sich das alte Geschäftsmodell in neue digitale Zeiten übertragen lässt. Aber journalistische Inhalte sind doch immer quer-finanziert gewesen. Ich kritisiere das nicht, das ist völlig in Ordnung. Nur muss man sich heute überlegen, wo die Quer-Finanzierung herkommt. Die Vorstellung, dass das, was Jahrzehnte lang ja letztlich über Stellen-, Auto-, Immobilienanzeigen oder Verlagsbeilagen, zu einem sehr hohen Anteil mitfinanziert wurde, sich das plötzlich alleine finanzieren können sollte, ist doch nicht realistisch. Also muss man schauen, wie Verlage – und das ist nicht das Problem der Redaktion, sondern das ist das Problem der Verlage – andere Erlösquellen aufmachen. Die einen machen es mit Katzenfutter, andere machen es mit journalistischen digitalen Rubriken vielleicht besser. Das ist aber die eigentliche Frage. Journalismus als solchen sozusagen auf die Straße zu schicken und zu sagen: „Schafft an!“ das hat noch nie funktioniert.
„Noch ganz viel Potenzial, wie man journalistische Inhalte in neue Formate bringen kann.“
Döbler: Es geht aus meiner Sicht nicht um Technologie, sondern darum, was für eine Marke man hat. Wenn man sich überlegt, was zum Beispiel Die Zeit, Handelsblatt oder Tagesspiegel machen, dann geht es eben nicht nur um das Digitale, sondern darum, was man mit der Marke macht. Ich glaube, dass der Weser-Kurier eine Marke ist, die man zu einem Diskursmedium in Bremen entwickeln kann. Also nicht mehr nur Zeitung, sondern auch ein Ort, wo Dinge stattfinden, Veranstaltungen, Konferenzen. Andere machen das vor. Es geht also gar nicht so sehr darum: „Bin ich digital oder bin ich noch Teil der Holzindustrie?“ Es geht vielmehr darum, was ich mit dieser Marke mache und was zu der Marke passt. Ich glaube, Weißwein oder so passt eben nicht, sondern Inhalte, Leute in den Dialog bringen, das passt sehr gut und das lässt sich auch refinanzieren. Ich glaube bloß, dass die unmittelbare Refinanzierung von journalistischen Inhalten im Netz im Moment noch nicht funktioniert.
Lumma: Das ist übrigens ein Phänomen, das nicht originär nur bei Verlagen so ist. Wenn man sich die Musikbranche anschaut, gab es ja dort auch eine Verlagerung vom CD-Verkauf hin zu mehr Konzerten oder mehr Web. Ich denke, da ist noch ganz viel Potenzial, wie man journalistische Inhalte in neue Formate bringen kann und dadurch wieder neue Möglichkeiten der Monetarisierung hat.
Querfurth (Publikum): Einen Gedanken möchte ich noch äußern. Jetzt kommt auch bei den Journalisten an, was wir Politikerinnen und Politiker jeden Tag erleben, nämlich die Kritik an uns und an unserer Person unabhängig von den Inhalten, die wir glauben, glaubwürdig zu vermitteln und für die wir stehen. Es ist ja eine interessante Erfahrung – offenbar auch für die Medien – jetzt selber in Frage gestellt zu werden. Das nehme ich sehr interessiert zur Kenntnis und freue mich darauf, was sich daraus entwickeln wird. Der zweite Gedanke ist der: Es gibt dieses Motto, „der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler“. Worüber wir heute alle reden, wenn wir die Angler sind, ist: „Wie bringen wir den Fisch dazu anzubeißen?“ Interessant ist doch die Frage aus der Warte des Fisches, sprich, der jungen Leute, der Jugendlichen von heute, nämlich: Was müssten wir eigentlich tun, damit sie dieses Medium in welcher Form auch immer konsumieren? Was bringen wir, wie müssen wir uns darstellen, unsere Inhalte darstellen, damit sie auch auf uns kommen, wenn sie zu bestimmten Fragen etwas wissen wollen.
Döbler: Ich glaube, kein Köder schmeckt allen Fischen, wir müssen uns entscheiden, für welche Fische wir arbeiten.
Loose (Publikum): Ich möchte auf einen Punkt zurückkommen, den Herr Döbler am Anfang angesprochen hat. Beim Google-Auto habe das Geschäftsmodell mit den Daten zu tun, die gesammelt werden. Ich glaube, ganz viele der Probleme, der Gefahren, über die wir gesprochen haben, sind, dass wir auch im Journalismus nur noch in Geschäftsmodellen denken. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, darauf haben Sie, Herr Metzger, hingewiesen, ist das anders. Langsam stellt sich auch da ein Umdenken ein, also stiftungsfinanzierter Journalismus als Beispiel. Auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen müssen wir stärker dahin kommen, nicht immer alles in Geschäftsmodellen zu denken, sondern mit den Daten auch andere wertvolle Dinge zu machen. Wir sehen eben, sobald sie ein Geschäftsmodell werden, tauchen damit auch jede Menge Probleme auf.
Kramp: Das kann man wahrscheinlich kommentarlos so stehen lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teilnehmern, bei Ihnen, dem Publikum, für Ihre Fragen.
