Prof. Dr. Heiko Staroßom
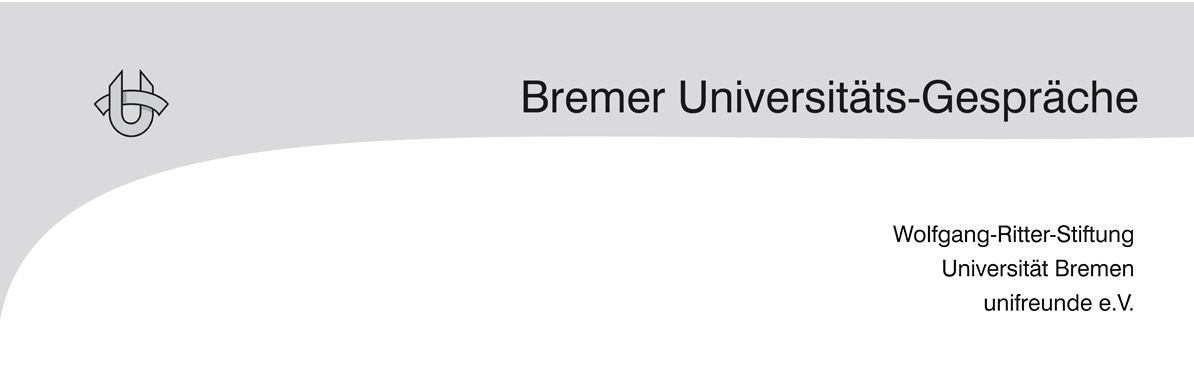
Tischrede
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Scotland-Saal des Atlantic Grand Hotels Bremen. Wieder einmal kommen wir zu den Bremer Universitäts-Gesprächen zusammen. Das diesjährige Thema lautet: Die Zukunft von Medien, Kommunikation und Information. Ein unglaublich spannendes Thema! Vor allem ist dies auch ein Thema, bei dem jede und jeder mitreden kann – und dies auch tut. Haben Sie schon einmal beobachtet, dass überall, wo Menschen zusammenkommen, die sich mindestens rudimentär kennen, sofort ein Gespräch beginnt. Die menschliche Sprache hat sechsundzwanzig Buchstaben und erzeugt damit unbegrenzt viele neue Sätze. Nun ja, so war es zumindest in der grauen Vergangenheit, vor dem Smartphone.
Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass Kommunikation etwas zutiefst Menschliches ist. Wir werden also ein Bremer Universitäts-Gespräch haben, welches uns alle betrifft. Wenn bei diesem Thema alle mitreden können, dann habe auch ich eine Chance, einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich möchte Sie teilhaben lassen an den Gedanken eines Menschen nach jahrzehntelangem Medien-, vor allem Zeitungskonsum.
Zunächst möchte ich mit einer eigenen Erfahrung aus diesem Frühjahr beginnen: Ende Januar dieses Jahres rief mich Christian Siedenbiedel an. Siedenbiedel ist ein Journalist für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, den ich aus meiner Zeit bei meinem vorigen Arbeitgeber kenne, als ich als Vorstandsvorsitzender den zweitgrößten Unfall der Genossenschaftsorganisation saniert habe – eine große Volksbank im vorderen Odenwald. Wir waren damals ausreichend spannend für die Medien, und ich erinnere mich an einige gute, konstruktive Gespräche mit Herrn Siedenbiedel und anderen Journalisten. Ich erinnere mich auch an eine insgesamt faire Berichterstattung in den Medien: Ich hatte nicht erwartet, dass die Zeitungen eine Werbebroschüre über uns verfassen würden. Ich war also positiv gestimmt, als Herr Siedenbiedel sich bei mir meldete.
Er begann mit einem kurzen Rückblick auf die alten Zeiten und erzählte dann, er sitze an einer Story darüber, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ja verbreiten würde, die von der EZB erzwungenen niedrigen Zinsen seien eigentlich ein Geschenk an die Banken. Wie ich denn dazu stehen würde? Damit hatte er bei mir den richtigen Knopf gedrückt. Ich war sofort im Kampfmodus! Wir haben uns dann sehr konstruktiv darüber ausgetauscht, dass natürlich zumindest die nordeuropäischen und deutschen Banken sehr unter der Niedrigzinsphase leiden, die Sparer enteignet werden und auf Dauer Kapital in falsche Verwendungen fließt.
Vieles davon fand ich am darauf folgenden Sonntag in der Zeitung inhaltlich richtig wieder. Auch das mit mir abgestimmte Zitat: „Wenn die Zinsen zehn Jahre so bleiben, muss man sich sehr große Sorgen machen“, war richtig wiedergegeben. Natürlich haben wir uns darüber ausgetauscht, dass dieser staatliche Eingriff in das Marktgeschehen alle Banken betrifft, große wie kleine, Institute aus allen Säulen der deutschen Kreditwirtschaft. Ich erwartete also entsprechend meinem Gespräch mit dem Journalisten einen Artikel über die Fakten verdrehende Rhetorik der EZB. Was aber war der Aufmacher dieses Artikels? „Wann schließen die ersten Sparkassen – mit einem umgedrehten Sparkassen-S. Die niedrigen Zinsen machen Sparkassen und Volksbanken das Geschäft kaputt. Lange halten sie das nicht mehr durch.“ Übrigens, die Sparkasse Bremen ist in diesem Jahr 190 Jahre alt geworden, und das zweitbeste Ergebnis in diesen 190 Jahren haben wir im vergangenen Jahr erzielt. Ich bin optimistisch, dass wir noch lange durchhalten und freue mich auf das Jubiläum für 200 Jahre und darüber hinaus.
Soweit meine aktuellen Erfahrungen. Dass ich mindestens für die nächsten zehn Jahre kuriert bin und jegliches Gespräch mit Journalisten meiden werde, das werden Sie wohl verstehen können. Aber die wenigsten von uns sind Teil einer Nachricht, die meisten konsumieren nur die Nachricht. Wie sieht es aus dieser Perspektive aus?
Die einschlägige historische Forschung ist sich ziemlich einig: Nicht – wie unsere technik- und medienbegeisterte Gegenwart anzunehmen geneigt ist – die Erfindung des modernen Buchdrucks als solche löste die erste neuzeitliche Medien- und Kommunikationsrevolution aus. Diese Erfindung gelang um 1450 dem Mainzer Patriziersohn und gelernten Feinschmied Johannes Gensfleisch genannt Gutenberg (1397 bis 1468). Vielmehr bewirkte erst der Tatbestand, dass Wissensbeschaffungs- und Wissensverbreitungsbedürfnisse bestimmter gesellschaftlicher Gruppen eine Massennachfrage nach Schriftgut erzeugten, eine teils stetig fortschreitende, teils schubartig verstärkte Nutzung und damit die Durchsetzung dieser neuen, komplex arbeitsteiligen und kapitalintensiven Spitzentechnologie. Die Geschichte des Buchdrucks und die Historie des europäischen Wissens sind also auf das Engste miteinander verflochten. Unsere moderne Wissensgesellschaft kündigt sich hier schon früh an.
Der Aufstieg der Zeitungen zum privilegierten Organ moderner Öffentlichkeit beginnt im frühen 17. Jahrhundert. Mit den Zeitungen wie der periodischen Presse insgesamt bildet sich eine säkulare Weltwahrnehmung heraus. Durch die Symbiose mit Wirtshaus, Kaffeehaus und Lesekabinetten sind Zeitungen ebenso sehr Gegenstand kollektiver wie individueller Lektüre, die Sucht nach Neuigkeiten kann durch Vorlesen auch illiterate Bevölkerungskreise erfassen. An den Auflagehöhen allein lässt sich daher die Dynamik nicht ablesen, mit der die Zeitungen den stets nachwachsenden Rohstoff Neuigkeit schon in die Kapillaren der Gesellschaft injizieren, ehe sie im 19. Jahrhundert ihren steilen Aufstieg zum Massenmedium erleben.
Schon Jean-Jacques Rousseau hat die Presse als die vierte Säule des Staates bezeichnet. Im Kontext der liberalen Theorie der Presse, die ihre Blütezeit im 19. Jahrhundert erlebte, wurde die Bezeichnung der Presse als „vierte Gewalt“ gebräuchlich. Die Medien stehen in diesem Verständnis neben den drei klassischen Gewalten Gesetzgebung (Legislative), Verwaltung und Polizei (Exekutive) und Rechtsprechung (Judikative). Damit werden die Institutionen der öffentlichen Meinung dem Prospekt einer horizontalen Aufteilung rechtskonformer Macht eingegliedert. Dort gehören sie natürlich nicht hin, auch wenn lange darüber gestritten worden ist, ob die Medien aufgrund ihres faktischen Einflusses auf die Politik doch neben den klassischen Gewalten stehen. Das aber ist ein Irrtum, weil Öffentlichkeit nur in Distanz zu allen anderen Instanzen des Gemeinwesens entsteht.
Falls die Presse also überhaupt eine Gewalt ist, so ist sie eine, die sich in grundsätzlicher Differenz gegen die anderen drei Gewalten zu behaupten hat. Die Idee, die Zukunft der papiergebundenen Zeitung aus öffentlichen Mitteln subventionieren zu wollen, mit dem Argument, sie sei notwendig für den Fortbestand der Demokratie, verlangt, dass sich die Zeitungen in Abhängigkeit von den Instanzen zu begeben hätten, deren reflexives Gegenüber sie sein müssen. Die Aufhebung dieser Distanz lädt zur Korruption ein, zumindest zum Korruptionsverdacht. Wenn die Öffentlichkeit kein Interesse mehr an dem Medium hat, wenn die Gesellschaft nicht länger auf sich selbst reflektieren will, dann kann keine öffentliche Subvention sie an dieser Selbstauflösung hindern. Bis dahin müssen wir zu verstehen suchen, dass Politiker in Medienkampagnen untergehen und dennoch nach Medienpräsenz gieren bis zur Würdelosigkeit, dass Medien genauso die Nähe der Politik suchen, und zwar jenseits reiner Berichtspflichten.
Mit dem Begriff Mediendemokratie drückt man aus, dass sich die politische Öffentlichkeit an den Darstellungsprinzipien der Massenmedien ausrichtet. Politisch wirklich ist nur das, was fotografierbar und erzählbar ist. Für Human Interest ist aber erst dann gesorgt, wenn alle Probleme personalisiert sind. Schließlich muss Aufmerksamkeit und Fortsetzbarkeit generiert werden, indem man der Story Konfliktform gibt. Das sind die formalen Bedingungen dafür, dass Politik als gute Unterhaltung verkauft werden kann.
In der Mediendemokratie werden politische Probleme nicht durchdacht, sondern gefühlt. Das erreicht man am einfachsten durch die Moralisierung eines Problems. Sie ermöglicht auch denen, die von der Sache nichts verstehen, an der Diskussion teilzunehmen. Moralisierung ist also eine Serviceleistung für Inkompetente. Sie haben es dann mit Menschen und Geschichten statt nur mit Ideen und Werten zu tun.
Je unübersichtlicher und komplexer die Welt wird, desto wichtiger werden Vereinfachungen. Unter modernen Medienbedingungen muss die Politik alle Probleme personalisieren. Die Stars der politischen Bühne ersparen uns dann Investitionen in Kompetenz und Urteilskraft. Hinzu kommen aber auch sachliche Gründe. Genau in dem Maße, in dem wir Komplexität durch Vertrauen reduzieren, muss die Politik personalisiert werden. Deutlicher gesagt: Die Personalisierung der Politik ist der Ausweg aus der Inkompetenz; das Urteil über Personen ersetzt das Urteil über Sachfragen.
Im großen Unterhaltungsprogramm der Öffentlichkeit bilden Politik, Medien und Demoskopie eine Endlosschleife. Talkshows und TV-Duelle sind Unterhaltungssendungen, in denen die Medien und die Politik sich gegenseitig inszenieren, umrahmt von Demoskopen und Experten, die in anschließenden Sendungen über die Sendung sicherstellen, was eigentlich zu hören und zu sehen war. Daraus kann man nicht nur lernen, dass Politik ein Teil der Unterhaltungsindustrie geworden ist, sondern auch, dass der Kern der Demokratie die Demoskopie ist. In dieser Form herrscht das Volk über seine politischen Führer. Demoskopie hilft den Leuten, ihre Wahl zu treffen, denn dazu müssen sie wissen, wie die anderen wählen; und sie hilft den Politikern, sich im Wahlkampf zu profilieren, denn dazu müssen sie wissen, was die Leute hören möchten. Die Wähler werden schließlich zu Zuschauern ihres eigenen vorausgesagten Verhaltens.
Eine Nachrichtensendung ist also dann gut, wenn sich die Zuschauer gut informiert fühlen. Wie überall in der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts heißt es auch hier: Der Kunde ist das Produkt. Und das Produkt einer guten Nachrichtensendung ist eben der Zuschauer, der sich gut informiert fühlt. Öffentliche Meinung ist damit nicht das, was die Leute meinen, sondern das, was die Leute meinen, was die Leute meinen.
Die Zeitung wendet sich immer an die Allgemeinheit. Doch ist die Allgemeinheit der Zeitung stets eine partikulare, in jeder Hinsicht: in Bezug auf die Auflage, den Preis, das Vertriebsgebiet oder, nicht zuletzt, das Bildungsniveau. Rechnet man zum Beispiel die Leser zusammen, die es in Deutschland für seriöse nationale Tageszeitungen gibt, kommt man auf nicht mehr als auf 2,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Addiert man die Leser der ernsthaften Wochenpresse hinzu, wobei man berücksichtigen muss, dass viele Menschen sowohl eine Tages- als auch eine Wochenzeitung beziehen, ist man vielleicht bei fünf Prozent der Bevölkerung. Und ist man schließlich großzügig und schließt anspruchsvolle Regionalzeitungen ein, ist immer noch von weniger als zehn Prozent aller Bürger die Rede. Anders gesagt: Die Zeitung ist eine elitäre Veranstaltung, ob man will oder nicht. Und: Die Zeitung ist elitär, nicht obwohl, sondern weil sie einen Anspruch auf Allgemeinheit erhebt. Sie ist repräsentativ, und sie muss sich als repräsentativ verstehen, weil ihre Aufgabe darin besteht, den festen Rahmen zu schaffen, in dem jede wichtige, neu hinzukommende Nachricht verhandelt wird.
Den Medien wird also oft Einfluss zugeschrieben. Einfluss gründet sich häufig auf Autorität, und von allen Qualitäten, die eine Zeitung oder – allgemeiner – Medieninstitution besitzen kann, ist eine allen Ereignissen übergeordnete Autorität die am schwierigsten zu erreichende.
Es gibt nur eine Art Autorität zu erwerben: durch Wissen, Klugheit, Verlässlichkeit, durch freie, begründete Urteile, die der Diskussion unterworfen werden. Das bedeutet auch, dass originelle Ideen die Autorität eines Mediums nur stützen, aber nicht garantieren können. Eine solche Autorität kann nur über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut werden. Und sie muss täglich verteidigt werden! Vertrauen schwindet, wenn das Publikum davon überzeugt ist, dass eine Koalition von Interessen das Vorkommen alternativer Ansichten oder Argumente im öffentlichen Austausch abwehrt.
Besitzen Medien, vor allem Zeitungen, einmal Autorität, dann verliert das Format (Papier oder Tablet oder Smartphone) an Bedeutung. Umfragen unter Lesern von Tageszeitungen belegen immer wieder, dass vor allem ein älteres Publikum zur Zeitung greift. Dazu gehöre mittlerweile auch ich. Dabei kann ich für mich ins Feld führen, dass ich schon seit meinem 17. Lebensjahr Abonnent einer großen deutschen Wochenzeitung aus Hamburg und später mehrerer Tageszeitungen war. Dagegen ist die Leserschaft bei heutigen Menschen unter vierzig und mehr noch unter dreißig Jahren gering und nimmt zudem auch noch ab. Gleichzeitig zeigen dieselben Untersuchungen, dass die Autorität der Zeitung dadurch nicht abnimmt: Sie ist in dieser Hinsicht auch beim jüngeren Publikum allen anderen Medien überlegen. Manch einer liest dann die Zeitung in der Ausgabe auf elektronischen Lesegeräten, wie meine Kinder.
Zu den vielen Scherzen, die Graf Bobby, einer erfundenen Figur aus dem Wien der fünfziger Jahre, zugeschrieben werden, gehört das gespielte Erstaunen darüber, dass auf der Welt an jedem Tag genauso viel passiert, wie in die Zeitung von morgen passt. In diesem Witz ist eine Einsicht in die Grundlagen der Zeitung verborgen: Es lässt sich zwar über alles schreiben, die Gegenstände und Schreibweisen sind virtuell unendlich. Aber man muss es auf einer begrenzten Fläche und für einen bestimmten Zeitpunkt tun. Lange Zeit war diese Begrenzung so selbstverständlich, dass man nicht darüber nachdachte. Heute steht sie jedoch in Kontrast zu den scheinbar unendlichen Möglichkeiten der digitalen Medien, und zwar sowohl in Bezug auf die räumliche Begrenzung als auch in Hinsicht auf die Bindung der Zeitung an die Zeit: Die Tageszeitung muss eben an einem Tag gedruckt und vertrieben werden. Danach verwandelt sie sich in Archiv und Altpapier. Diese beiden Elemente – temporale und stoffliche Abgeschlossenheit – gehören zu den Grundbestimmungen jedes Exemplars einer auf Papier gedruckten Tageszeitung.
Eines der Motive, die seit der Herausbildung der gedruckten Zeitung im frühen 17. Jahrhundert die Entwicklung der Medien vorantrieben, war die Verringerung des zeitlichen Abstands zwischen dem Ereignis und seiner Einspeisung in die Zirkulation als Nachricht. Dass die gedruckte Tageszeitung mit schnelleren Medien konkurrieren muss, ist also nichts Neues. Seit fast hundert Jahren ist sie langsamer als der Rundfunk, seit etwa sechzig Jahren langsamer als das Fernsehen. Diese Konkurrenz hat der großen, seriösen Tageszeitung bisher nicht nachhaltig geschadet. Im Gegenteil, in Deutschland waren die neunziger Jahre – die Jahre nach der allgemeinen Durchsetzung des Privatfernsehens und des PCs – für die Zeitungen eine der erfolgreichsten Perioden ihrer jüngeren Geschichte.
Der fundamentale Unterschied zwischen der damaligen und der heutigen Konstellation besteht darin, dass die Digitalisierung die Zeitung jetzt selbst erreicht hat: Sie ist Teil der Zeitung geworden. Zunächst in ihrem Produktionsprozess, dann in der Distribution. Während die papiergebundene Zeitung also so langsam geblieben ist, wie sie das seit Jahrzehnten ist (sie ist, nach dem Wegfall der Extrablätter, sogar langsamer geworden), hat sie gleichzeitig Anteil an den schnellsten, an den digitalen Medien. Auf der einen Seite gebunden an Papier und Druck, tritt sie gleichzeitig als Repräsentantin höchster Aktualität auf. Möglich ist dies, weil es sich beim Internet nicht, wie beim Rundfunk und beim Fernsehen, um ein anderes Medium, sondern um eine neue Infrastruktur für Medien handelt. Die Beschleunigung der Medien, die vor zweihundert Jahren begann, ist indessen an ihrem historischen wie systematischen Ende angekommen. Die Nachricht hat das Ereignis erreicht, in Gestalt der sozialen Medien. Das aber hat nicht nur zur Folge, dass die Nachrichtenagenturen ihr Monopol verlieren, sondern auch, dass die Beschleunigung des Nachrichtenflusses aufhört, das letzte und entscheidende Kriterium in der Konkurrenz der Medien zu sein.
Es wäre aber ein Irrtum zu glauben, die Internetausgabe sei gegenüber der gedruckten Tageszeitung das durchgängig aktuellere Medium. In jeder Netzausgabe (und das gilt für alle Zeitungen) stehen Artikel, die wesentlich älter sind als die Zeitung von gestern. Online bedeutet also keineswegs nur einen höheren Grad von Aktualität, sondern auch einen höheren Grad von Archiv.
Unter denjenigen, die gegenwärtig in der Öffentlichkeit über die Zukunft der Zeitung sprechen, zählt die Mehrheit offenbar zu einer besonderen Art von Adventisten. Diese sind überzeugt davon, der endgültige Triumph der digitalen über die papiergebundenen Medien sei schon bald zu erwarten. Doch beruft sich dieser Adventismus auf einen tautologischen Gedanken, darauf nämlich, die nächste Zukunft könne gar nicht anders, als eine Fortsetzung der jüngeren Vergangenheit zu bilden. Zwar haben sich die Zeitungen in den vergangenen zwanzig Jahren sehr verändert und sind von ausschließlich papiergebundenen Unternehmungen zu Mischwesen zwischen Papier und Digitalem geworden. Doch ist es keineswegs gewiss, dass diese Mischwesen nur Phänomene des Übergangs sind. Mindestens genauso wahrscheinlich ist es, dass die Doppelstruktur von Print und digitalen Medien erhalten bleibt. Und es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die Mischwesen in Zukunft wieder größere Anteile Papier enthalten. Tatsächlich erwächst die größte Zukunftschance der gedruckten Zeitung aus der Konsequenz, mit der sie dem Überfluss von Optionen im Netz die Verknappung der Optionen im Print gegenüberstellt, redaktionell wie technologisch.
Ich werde also auch in Zukunft ein eifriger Zeitungsleser bleiben!

