3. Sonderfall: Öffentliche Wiedergabe
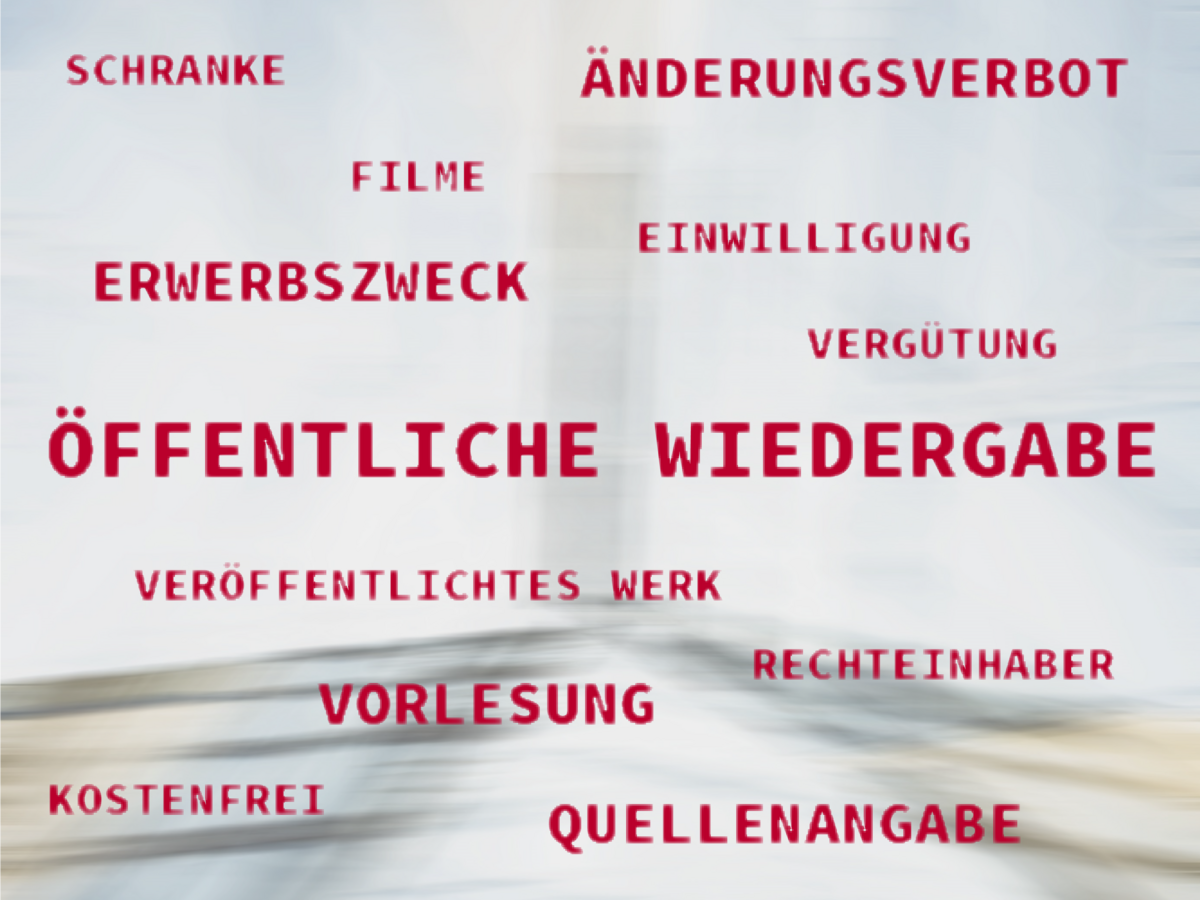
Öffentliche Wiedergabe
Werke dürfen ohne Zustimmung des Rechteinhabers öffentlich wiedergegeben werden. Voraussetzung ist, dass die Wiedergabe keinen Erwerbszweck hat und die Teilnahme kostenlos ist. Der Rechteinhaber hat Anspruch auf Vergütung.
Eine öffentliche Wiedergabe ist eine Nutzungshandlung. Wenn Sie fremde Werke auf diese Weise nutzen möchten, aber keine Lizenz dafür erworben haben, können drei Schrankenbestimmungen zur Anwendung kommen:
- § 60a Absatz 1 Nr. 1 UrhG: Zweck der öffentlichen Zugänglichmachung von veröffentlichten Werken muss die Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre sein. Diese muss durch Personen erfolgen, die eine institutionelle Verbindung zu der jeweiligen Bildungseinrichtung haben. Es ist nicht erlaubt, die Werke nur zu Unterhaltungszwecken (z.B. Pausenfüller, Entspannung; ohne Bezug zur Veranstaltung) zu verwenden. Ausführliche Informationen zu § 60a UrhG finden Sie weiter unten.
- Zitatrecht (siehe Leitfrage 3)
- § 52 UrhG.
§ 52 UrhG ist eine gesetzliche Schrankenbestimmung, die es jedem gestattet, veröffentlichte Werke ohne Zustimmung des Rechteinhabers öffentlich wiederzugeben. Veröffentlicht“ ist ein Werk gemäß § 6 Absatz 1 UrhG, wenn es mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.
Die Schrankenbestimmung von § 52 UrhG kann angewendet werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
- Die Wiedergabe dient dem Veranstalter nicht dem Erwerbszweck
- Die Teilnehmer bezahlen für die Wiedergabe kein direktes Entgelt.
- Keiner der etwaig mitwirkenden Künstler (z.B. Schauspieler, Musiker) erhält eine besondere Vergütung (erlaubt sind aber die Erstattung von Reisekosten oder die Bereitstellung von Speisen und Getränken im üblichen Umfang).
Exkurs: Wann ist eine Wiedergabe öffentlich?
Eine Wiedergabe ist gemäß § 15 Absatz 3 UrhG dann öffentlich, „wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.“
Auf die Hochschule angewendet bedeutet dies: Hochschulvorlesungen sind z.B. aufgrund des großen Teilnehmerkreises in der Regel öffentlich (die Studierenden kennen sich zumeist nur oberflächlich „vom Sehen“). Lehrveranstaltungen mit einer niedrigeren Teilnehmerzahl, wie z.B. Seminare, sind in der Regel nicht-öffentlich, da unter den Teilnehmern ein engerer persönlicher Kontakt besteht (vgl. auch Urteil des OLG Koblenz vom 7.8.1986, Az.6 U 66/83 - NJW-RR 1987, 699 ff.).
Wenn die Wiedergabe nicht-öffentlich ist, bestehen normalerweise keine urheberrechtlichen Einschränkungen, d.h. für die Nutzung muss weder eine Schranke des Urheberrechts bestehen, noch muss eine Nutzungserlaubnis vom Rechteinhaber eingeholt werden. Es müssen aber die Persönlichkeitsrechte beachtet werden.
Folgende Nutzungen bedürfen immer der Einwilligung des Rechteinhabers (§ 52 Absatz 3 UrhG):
- Öffentliches Vorführen von Filmwerken
- Öffentliche Zugänglichmachung durch das Einstellen in das Internet. Wenn Sie Werke für Unterricht und Lehre online zur Verfügung stellen möchten, kann auch § 60a UrhG zur Anwendung kommen. Mehr hierzu siehe unten.
- Ausstrahlung von Hörfunk und Fernsehen
- Öffentliche, bühnenmäßige Darstellung. Keine bühnenmäßige Darstellung liegt vor, wenn Musikwerke aus Musicals, Opern oder Operetten konzertant und ohne bewegtes Spiel aufgeführt werden oder wenn Bühnenwerke nur als Lesung dargebracht werden
Computerprogramme dürfen ebenfalls nur mit Zustimmung des Rechtsinhabers öffentlich wiedergegeben werden (§ 69c Nr. 4 UrhG).
Die Schrankenbestimmung der öffentlichen Wiedergabe (§ 52 UrhG) wird bei den folgenden Werkarten wie folgt angewendet:
- Sprachwerke (literarische und wissenschaftliche Werke; § 2 Absatz 1 Nr. 1 UrhG) dürfen öffentlich vorgetragen werden;
- Musikwerke dürfen sowohl live als auch durch Aufnahmen wiedergegeben werden, wobei keine privaten Aufnahmen benutzt werden dürfen (§ 53 Absatz 6 UrhG).
- Werke der bildenden Kunst (z.B. Gemälde, Plastiken, Skulpturen; § 2 Absatz 1 Nr. 4 UrhG), Lichtbildwerke (Fotografien; § 2 Absatz 1 Nr. 5 UrhG) und Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art (z.B. Stadtpläne, Karten, Skizzen;§ 2 Absatz 1 Nr. 7 UrhG) dürfen im Original oder in Kopie präsentiert werden.
Die Quellenangabe ist bei der öffentlichen Wiedergabe eines Werkes nur notwendig, wenn die bestehende Verkehrssitte dies erfordert (§ 63 Absatz 2 Satz 1 UrhG). Eine Verkehrssitte ist die schon längere Zeit den Rechtsverkehr beherrschende tatsächliche Übung. Konkret bedeutet dies, dass eine Quellenangabe dann erforderlich ist, wenn loyale, billig und gerecht denkende Benutzer, die den Belangen des Urhebers mit Verständnis gegenübertreten, eine Quellenangabe machen. Lässt sich das Bestehen der Verkehrssitte nicht zweifelsfrei klären, besteht keine Pflicht zur Angabe der Quelle. Keine Verkehrssitte zur Quellenangabe besteht beispielsweise vor Beginn der öffentlichen Wiedergabe eines Musikstückes (erforderlich könnten hier aber Hinweise in einer begleitenden Dokumentation sein, z.B. einer Übersicht zum Veranstaltungsablauf).
Neben der Bezeichnung des Urhebers ist auch die Fundstelle anzugeben. Die Quellenangabe muss zudem deutlich sein. Sie muss so platziert werden, dass der Urheber und die Fundstelle ohne Mühe zu erkennen sind.
Das übernommene Werk darf nicht geändert werden.
Änderungen sind nur ausnahmsweise zulässig (§ 62 Absatz 2 - 4 UrhG). Zulässig ist die Übersetzung von Texten, wenn der Benutzungszweck es erfordert (§ 62 Absatz 2 UrhG). Bei Werken der bildenden Künste (z.B. Gemälde) und bei Lichtbildwerken (Fotografien) ist die Änderung der Größe (Formatänderung) zulässig. Zudem sind diejenigen Maßnahmen gestattet, die das jeweilige Vervielfältigungsverfahren mit sich bringt, z.B. die Reproduktion von Farbfotografien in Schwarz-Weiß-Fotografien (§ 62 Absatz 3 UrhG).
Vergütung bei Nutzung nach § 52 UrhG
Wenn die Anforderungen der gesetzlichen Schrankenbestimmung der öffentlichen Wiedergabe (§ 52 UrhG) erfüllt sind, ist die öffentliche Wiedergabe - wie in Lehrveranstaltungen an Hochschulen - ohne Zustimmung des Rechteinhabers zulässig. Für die Wiedergabe ist aber eine angemessene Vergütung zu zahlen. Die Vergütung wird durch eine Verwertungsgesellschaft - wie beispielsweise die GEMA für Musikwerke - geltend gemacht und von der Hochschule gezahlt.
Vergütung bei Nutzung nach § 60a UrhG
Vergütungsfrei ist unter den Voraussetzungen der Schrankenbestimmung des § 60a UrhG im Hochschulbereich die öffentliche Wiedergabe (§ 15 Absatz 2 UrhG) für Angehörige von Bildungseinrichtungen und deren Familien nach § 60a Absatz 1 Nr. 1 und 3 sowie Absatz 2 UrhG. Dies sind Nutzungen in Lehrveranstaltungen zur Veranschaulichung von Unterricht und Lehre, wie beispielsweise das Abspielen von Musik im Rahmen von Vorlesungen oder die Nutzung von Werken, wie Fotografien, in Vorlesungspräsentationen. Nicht vergütungsfrei ist aber die öffentliche Zugänglichmachung (Bereitstellung über Internet oder Intranet). Ausführliche Informationen hierzu finden Sie bei Leitfrage 4.
Vergütung bei Nutzung nach § 51 UrhG (Zitate)
Zitieren unter den Voraussetzungen von § 51 UrhG ist vergütungsfrei. Wie Sie rechtssicher urheberrechtlich geschützte Materialien ohne Zustimmung des Rechteinhabers im Rahmen des Zitatrechts verwenden können, wird Ihnen bei Leitfrage 3 erläutert.
Begriffserklärungen
Schranken des Urheberrechts
Das Urheberrechtsgesetz enthält Ausnahmen, die sogenannten Schrankenbestimmungen. Sie gestatten es, urheberrechtlich geschützte Werke auch ohne Einwilligung des Rechteinhabers zu nutzen. Mit den Schranken soll ein Ausgleich zwischen den Interessen des Urhebers und denen der Gesellschaft geschaffen werden. Die Voraussetzungen für die verschiedenen gesetzlichen Nutzungserlaubnisse sind in den Paragraphen § 44a ff. UrhG geregelt.
[Themen 2-7: Sonderfälle]
Lizenz
Als Lizenz wird in der Umgangssprache die Erlaubnis bezeichnet, ein urheberrechtlich geschütztes Werk zu nutzen. Bei einer Lizenz handelt es sich also um die Einräumung eines Nutzungsrechts für einen rechtlich geschützten Inhalt.
Nutzungsrechte
Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, sein Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen. Nutzungsarten sind z.B. Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe. Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt eingeräumt werden (§ 31 Absatz 1 UrhG).
Weitere Informationen in der Wissensplattform
Der Rechtsstand ist Mai 2018.
