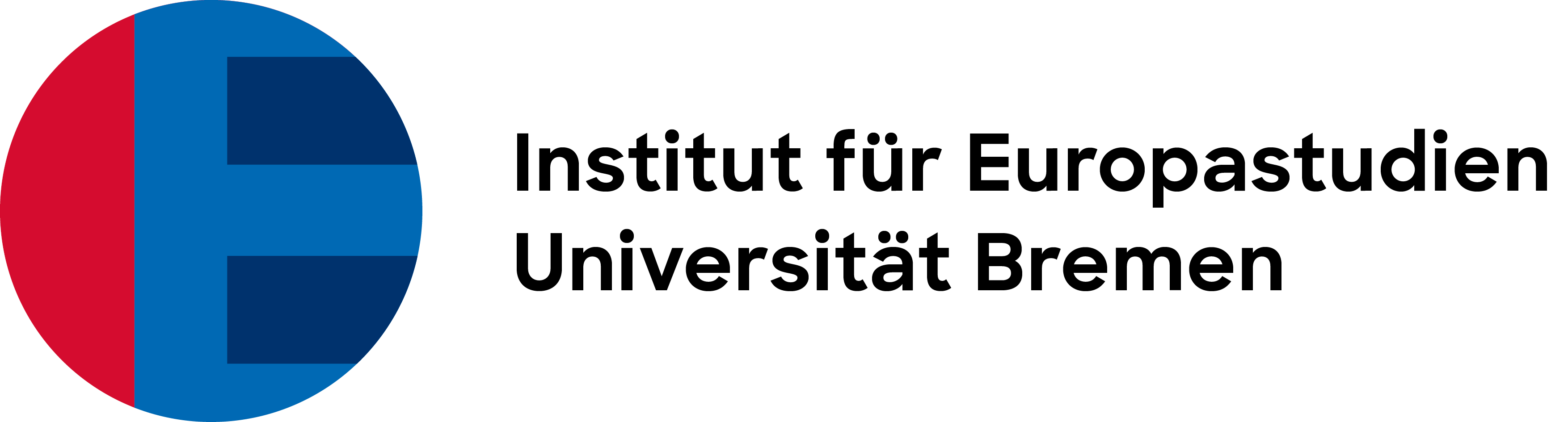Organisierte Interessen und Rechtsmobilisierung im europäischen Gerichtsverbund
Projektbeschreibung
Das Projekt geht der Frage nach, unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Zielen und in welcher Form organisierte Interessen das Rechtssystem nutzen. Unter Schlagworten wie Verrechtlichung (juridification), Rechtsmobilisierung (legal mobilization) und strategischer Prozessführung (strategic litigation) beschäftigt sich eine umfangreiche, an der Schnittstelle von Rechts- und Politikwissenschaft angesiedelte Literatur mit der Frage, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen das Recht in Anschlag gebracht wird, um politische Entscheidungen zu beeinflussen. Der bisherige Stand der Forschung soll in dreierlei Hinsicht erweitert werden. Erstens nimmt das Projekt eine akteursvergleichende Perspektive ein, die unter organisierte Interessen nicht nur Verbände oder Nichtregierungsorganisationen fasst, sondern auch Unternehmen als bislang wenig berücksichtigte Akteure der Rechtsmobilisierung. Zweitens gilt ein besonderes Augenmerk dem Stellenwert, den die Berufung auf das Unionsrecht und auf Grundrechte im Zusammenhang mit einer Strategie justizieller Interessenvermittlung hat. Drittens – und damit zusammenhängend – widmet sich das Projekt der Frage, welche Konsequenzen sich aus der Struktur des europäischen Gerichtsverbunds für das strategische Handeln organisierter Interessen ergeben. In diesem Gerichts- und Rechtsprechungsverbund existieren neben den in der nationalen Verfassung verankerten Grundrechten mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und der Europäischen Menschenrechtskonvention weitere Grundrechtskataloge, aus denen Individuen und Organisationen Rechtsansprüche ableiten und mithilfe derer sie Grundrechtsverstöße geltend machen können. Zugleich koexistieren voneinander unabhängige, aber miteinander verschränkte Höchstgerichte – für den Fall Deutschlands das Bundesverfassungsgericht, der Gerichtshof der Europäischen Union sowie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Diese prüfen von Individuen und Organisationen geltend gemachte Grundrechtsverstöße anhand unterschiedlicher Maßstäbe und eröffnen damit Spielräume für strategische Prozessführung. Darüber hinaus sind – insbesondere wo es um das Handeln der öffentlichen Gewalt geht – nationale Fachgerichte Agenten der Anwendung und Durchsetzung von Unionsrecht. Dies eröffnet organisierten Interessen in Fällen, in denen es auf die Auslegung von Unionsrecht ankommt, über das Vorabentscheidungsverfahren den Weg zum Europäischen Gerichtshof.
Das Projekt bedient sich eines mixed-methods-Designs. Mithilfe explorativer Interviews mit Vertreter:innen aus 30 Organisationen wird in einem ersten Schritt analysiert, welche Absichten, Ziele und organisationsinternen Abwägungen hinter der Mobilisierung des Rechts stehen und welche situativen, kontextuellen Faktoren die strategischen Überlegungen beeinflussen. In einem zweiten Schritt wird eine Umfrage unter rund 2000 Organisationen mit Sitz in Deutschland durchgeführt. Die Umfrage soll Aufschlüsse über die die bisherigen Erfahrungen mit rechtlichen Auseinandersetzungen, die organisationsinternen Ressourcen und Entscheidungswege und die relative Bedeutung des Rechtswegs für die Interessenvermittlung liefern. Mit einer akteurzentrierten Perspektive auf das Phänomen Rechtsmobilisierung, die qualitative und quantitative Forschungszugänge kombiniert, schlägt das Projekt eine Brücke zwischen der Interessengruppenforschung und der interdisziplinären Forschung zu Recht und Politik und liefert neue Erkenntnisse über die Mechanismen der Rechtsmobilisierung im Kontext demokratischer Interessenvermittlung.

Projektleitung
Projektlaufzeit
1.10.2023 - 30.09.2026
Drittmittelgeber
Deutsche Forschungsgemeinschaft
Projektrelevante Publikationen
Thierse, Stefan/Pia A. Lange (2026): Power to the people – Power to the court? Constitutional complaints and the legal mobilisation of the ‘right to democracy’. In: European Law Open (i.E.)
Thierse, Stefan/Sanja Badanjak (2021): Opposition in the EU Multi-Level Polity. Legal Mobilization against the Data Retention Directive. Cham: Palgrave Macmillan.
Thierse, Stefan (2020): Mobilisierung des Rechts. Organisierte Interessen und Verfassungsbeschwerden vor dem Bundesverfassungsgericht. In: Politische Vierteljahresschrift, 61 (3), 553-597.